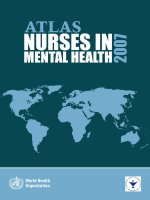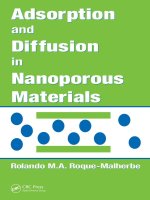(schnelleinstieg) schnelleinstieg in die buchführung (2007)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 215 trang )
Was Ihnen die CDROM bietet
Mit der Lernsoftware „eTraining Buchhaltung” von lexware können
Sie parallel zum Buch u. a. folgende Themengebiete trainieren:
● Bilanz
● Sach- und Personenkonten
● Buchungssatz
● Buchen der Belege
● Monats- und Jahresabschluss
● usw.
Viele Übungen und Tests mit Lösungen geben Ihnen die nötige
Sicherheit. Tempo und Lernphasen bestimmen Sie selbst.
Systemvoraussetzungen
Sie brauchen auf Ihrem PC das Betriebssystem Windows 95, 98,
2000 an Service Pack 3, einen Pentium-Prozessor, eine VGA-Grafik-
karte und einen Festplattenspeicher (mind. 64 MB).
Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über
abrufbar.
ISBN10: 3448079596 BestellNr. 011420006
ISBN13: 9783448079593
1. Auflage 2000 (ISBN 3448040789)
2., überarbeitete Auflage 2002 (ISBN 3448051349)
3., erweiterte Auflage 2003 (ISBN 3448056324)
4., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2004 (ISBN 3448064351)
5., überarbeitete Auflage 2007
© 2007, Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG,
Zweigniederlassung Planegg bei München
Redaktionsanschrift: Postfach, 82142 Planegg
Hausanschrift: Fraunhoferstraße 5, 82152 Planegg
Telefon (089) 8 95 17 0
Telefax (089) 8 95 17 250
www.haufe.de,
Lektorat: Dipl.Kffr. Kathrin MenzelSalpietro
Redaktion: Helmut Haunreiter
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen
Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken
oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
DesktopPublishing: Helmut Haunreiter, 84533 Marktl
Umschlaggestaltung: 102prozent design, Simone Kienle, 70199 Stuttgart
Druck: Bosch Druck GmbH, 84030 Ergolding
Zur Herstellung der Bücher wird nur alterungsbeständiges Papier verwendet.
Schnelleinstieg
in die Buchführung
von
Dr. Gerhard Fröhlich
5. Auflage
Haufe Mediengruppe
Freiburg · Berlin · München · Würzburg
4
Inhaltsverzeichnis
A Elementarwissen 9
1 Kaufmännische Aufzeichnungspflichten 9
2 Beschaffenheit der Buchführung 15
3 Die Bilanz im Mittelpunkt der Buchführung 21
4 Die Inventur als Ausgangspunkt der Buchführung 27
5 Von der Bilanz zum Konto 37
6 Der Buchungssatz 47
7 Das Journal 52
8 Das Schlussbilanzkonto 56
9 Die Gewinn und Verlustrechnung 61
10 Die Umsatzsteuer beim Einkauf und beim Verkauf 74
11 Ein Zwischenergebnis 85
B Buchführung in der Geschäftspraxis 89
1 Die Nummerierung von Konten 89
2 Buchungen im Ein und Verkaufsbereich 100
3 Buchungen im Wechselverkehr 110
4 Buchung von Personalaufwendungen 115
C Jahresabschluss 124
1 Vorbereitende Abschlussbuchungen 124
2 Abschreibung für Anlagegüter/Absetzung für Abnutzung 127
3 Bestände und Verbrauch von Material 133
4 Die Hauptabschlussübersicht 140
5 Abschlussübungen 149
D Abgrenzungsposten und Rückstellungen 155
1 Abgrenzungsposten 156
2 Rechnungsabgrenzung 157
3 Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten 160
4 Rückstellungen 161
Inhaltsverzeichnis
5
E
Rücklagen 165
Sonderposten mit Rücklagenanteil 166
F Die Organisation der Buchführung 169
1 Die EDV ist das Instrument der Gegenwart 170
2 Warum der lexware buchhalter? 174
3 Einführung 176
4 Erste Schritte mit dem lexware buchhalter 176
5 Die Kontokorrentbuchführung mit „offenen Posten“ 180
6 Einsatz des lexware buchhalters zur Vermeidung von
Doppelarbeiten im Unternehmen 184
G Lösungen der Übungsaufgaben 191
Übungsaufgabe 1 191
Übungsaufgabe 2 191
Übungsaufgabe 3 192
Übungsaufgabe 4 193
Übungsaufgabe 5 194
Übungsaufgabe 6 194
Übungsaufgabe 7 195
Übungsaufgabe 8 195
Übungsaufgabe 9 196
Stichwortverzeichnis 198
Die 27 wichtigsten Leitsätze 201
Übersichten und Checklisten 208
6
Vorwort
Es ist vielfach nötig, sich die Grundlagen der kaufmännischen Buch-
führung anzueignen. Sie müssen z. B. eine Reihe von Buchfüh-
rungsaufgaben lösen, wenn Sie die Kaufmannsprüfung bei der In-
dustrie- und Handelskammer ablegen. Oder Sie stehen als künftiger
Handwerksmeister vor dem Problem, dass Sie Ihren Meisterbrief
erst dann bekommen, wenn Sie Grundkenntnisse in der Buchfüh-
rung nachgewiesen haben. Möglicherweise gehören Sie auch zu den
vielen Unternehmern, die bisher nie Zeit, Lust oder einen Anlass
hatten, Buchführung zu lernen, und nun haben Sie sich entschlos-
sen, in kürzester Zeit im Detail verstehen zu wollen, was Ihnen Ihr
Buchhalter oder Steuerberater zeigt.
Das vorliegende Buch wird Ihnen in jedem Fall den richtigen Ein-
stieg liefern. Es ist ebenso umfassend wie kompromisslos praxis-
orientiert. Es enthält das gesamte Grundlagen- und das unabdingba-
re Anwenderwissen zum Thema Buchhaltung. Als Maßstab diente
dabei das Wissensniveau, das für das Bestehen der kaufmännischen
Prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer vorausgesetzt
wird. Das Buch wendet sich an Auszubildende, Berufsschüler, Meis-
terschüler ebenso wie an Existenzgründer, Selbstständige und ande-
re Einsteiger in das Thema Buchführung.
Häufig zeigt die Praxis, dass beim Erlernen der Buchführung mehr
Verwirrung als Klarheit entsteht und dadurch das gesamte Thema
einen exponierten Platz in der Kategorie der unbeliebten Fächer
bekommt.
Das ist schade und völlig unnötig! Buchhaltung kann sehr interes-
sant, ja sogar spannend sein und vor allem – sie ist absolut logisch.
Der „Schnelleinstieg in die Buchführung“ ist umfassend und doch
locker fassbar und auch dann noch eingängig, wenn ein harter Tag
der Arbeit oder des Studiums hinter dem Leser liegt, der danach
sucht, die vielen Details der Buchführung systematisch zu ordnen
und damit besser zu verstehen.
Vorwort
7
Ich habe selbst als Buchhalter gearbeitet und bin heute als Dozent
tätig. Als Wirtschaftsberater und Inhaber einer Firma für Datenver-
arbeitung und Kontierung unterstütze ich meine Kunden bei der
Buchung ihrer laufenden Geschäftsfälle. Als Lehrer habe ich viele
Auszubildende zum Bestehen ihrer Prüfung geführt. Diese langjäh-
rigen beruflichen Erfahrungen habe ich jetzt für Sie nutzbar ge-
macht: Sie werden sehen, dass 17 wirklich verstandene Geschäftsfäl-
le die Basis bilden. Die hier vermittelten „Tipps und Tricks” für
Einsteiger zur Aneignung des Basiswissens der Buchhaltung sind auf
jene Hürden gerichtet, die Neulinge erfahrungsgemäß im Alleingang
schwer meistern. Und gerade die Gründlichkeit, mit der Sie sich das
buchhalterische Basiswissen aneignen, ist der Schlüssel dazu, die
Informationen des Rechnungswesens zu verstehen. Dadurch kön-
nen Sie Entscheidungen schneller treffen, sparen unnötige Steuern –
und haben nicht zuletzt auch die Voraussetzungen, um eine ggf.
abzulegenden Prüfung zum Thema Buchführung zu bestehen.
Ein Hinweis sei noch gestattet. Das Anliegen des Buches besteht in
der Vermittlung von Grundlagen, die langjährigen Bestand haben.
Dennoch wurden einige Beispiele nach Fassungen von Steuergeset-
zen aufgebaut, die zum angegebenen Zeitpunkt gültig waren, mögli-
cherweise aber schon wieder verändert sind oder zur Diskussion
stehen. Detailregelungen einiger Gesetze unterliegen in jüngerer Zeit
einem geradezu atemberaubenden Wandel. Für die tägliche Praxis
bleibt dem Leser daher nicht erspart, sich über den neuesten Geset-
zesstand auf dem Laufenden zu halten.
Ich möchte Sie, lieber Leser, darum bitten, Ihre Anregungen, Fragen
und Kritik an die Redaktion zu richten. Ihre Vorschläge können
dann in künftigen Auflagen berücksichtigt werden.
Gerhard Fröhlich
Vorwort
8
Hinweis zur Benutzung
Das Paragraphensymbol am Rand weist auf Zitate aus den für die
Buchführung relevanten Gesetzestexten hin.
Übungen sind durch das links abgebildete Symbol gekennzeichnet.
Sollten Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten, finden Sie in den Pas-
sagen, die mit dem Ausrufezeichen hervorgehobenen sind, wertvolle
Hinweise.
9
A Elementarwissen
Die Prinzipien der doppelten Buchführung gibt es schon seit ca. 500
Jahren. Obwohl sich die äußere Form, in der diese Prinzipien zum
Ausdruck kommen, immer wieder geändert und den Erfordernissen
der Zeit angepasst hat, bis hin zur computergeführten Buchführung,
ist die Substanz doch immer die gleiche geblieben.
Das Elementarwissen umfasst das Wissen, das für die doppelte
Buchführung allgemein gilt. Es sollen die Grundbestandteile – die
Elemente – erklärt werden, die über die Jahrhunderte gleich geblie-
ben sind. Sie gelten heute weltweit überall dort, wo doppelte Buch-
führung praktiziert wird, also zum Beispiel in den USA, in England,
Polen oder Russland. Das gründliche Verstehen dieser Elemente ist
die wichtigste Voraussetzung, um im nächsten Schritt die komple-
xen Vorgänge der täglichen Geschäftspraxis zu erfassen und damit
schöpferisch und nicht nur formal umzugehen.
Noch ein wichtiger Hinweis: Das vorliegende Buch wird Sie syste-
matisch mit der Buchführung vertraut machen, ausgehend von
einfachen hin zu immer komplexeren Vorgängen. Gründlichkeit
beim Aneignen des buchhalterischen Elementarwissens ist der
Schlüssel zum wirklichen Verstehen. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen spannende Unterhaltung.
1 Kaufmännische Aufzeichnungspflichten
Warum ist die Buchführung in der kaufmännischen Praxis so wich-
tig? Ist die Aufzeichnungspflicht nur eine lästige Pflicht, der man auf
Grund gesetzlicher Bestimmungen nachkommen muss?
Kaufleute haben sich seit jeher zu ihrem eigenen Vorteil der allge-
mein akzeptierten Praxis der Buchführung angeschlossen. So muss
z. B. jeder, der in der Wirtschaft tätig ist, nicht nur branchenspezifi-
sches Wissen haben, sondern auch über unternehmerischen Sach-
A Elementarwissen
10
verstand verfügen. Dies trifft nicht nur für Unternehmer, sondern
genauso auch für Angestellte zu. Ein Schlüssel zum kaufmännischen
Denken und Handeln ist das Verständnis der Prinzipien der Buch-
führung.
Die unternehmerische Tätigkeit ist ein dynamischer Prozess, über
den der Unternehmer den Überblick behalten muss. Blindflug ver-
bietet sich hier von selbst. Kaum ein Kaufmann kann jedoch all
seine Transaktionen im Kopf behalten – er muss sie aufschreiben.
Warum aber darf ich meine Aufzeichnungen nicht so anlegen, wie
ich will, sondern bin engen Regeln unterworfen? Die Buchführung
dient nicht nur der eigenen Information, sondern ist auch ein wich-
tiges Kommunikationsmittel, und zwar sowohl innerhalb eines
Betriebes, als auch nach außen. Wenn aber z. B. Unternehmen,
Banken oder Finanzbehörden verschiedene „Sprachen“ sprechen, ist
die Kommunikation gestört.
Es steht somit sowohl bei der Frage, warum Buchführung erforder-
lich ist, als auch bei der Frage nach dem „Wie“ das Eigeninteresse
des Kaufmanns, also Ihr eigenes Anliegen, im Vordergrund.
Was die unternehmerische Vernunft also ohnehin gebietet, hat der
Gesetzgeber inzwischen zur Pflicht erhoben. Seit dem 19. Dezember
1985 gibt es ein ganzes Paket verbindlicher gesetzlicher Vorschrif-
ten, in die alle bewährten Prinzipien der Buchführung eingeschlos-
sen sind. Auf diese Weise wurde ein einheitlicher Rahmen geschaf-
fen. Die Vorschriften sind im Bilanzrichtliniengesetz – BiRiLiG
(Gesetz zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordi-
nierung des Gesellschaftsrechts, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt
am 24.
12. 1985, Teil I Nr. 62) – enthalten. Mit diesem Gesetz wurde
ein neues, ein „Drittes Buch” in das Handelsgesetzbuch (HGB)
aufgenommen, das den Titel „Handelsbücher” trägt. Dem Kauf-
mann wird nunmehr durch Gesetz in klarer Sprache vorgeschrie-
ben, was er sowieso tun müsste.
Sehen Sie dazu den § 238 des HGB. Er schreibt u. a. vor:
Kaufmännische Aufzeichnungspflichten A
11
Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine
Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen.
Der Gesetzgeber stützt die kaufmännischen Aufzeichnungspflichten
aber nicht nur auf das HGB. Jeder Kaufmann muss „doppelt” den-
ken, nämlich außer an das Handelsrecht auch an das Steuerrecht.
Dazu der § 140 der Abgabenordnung:
Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Auf-
zeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung
sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen
obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen.
Eindeutig ist, dass mit den „anderen Gesetzen” vor allem das HGB
gemeint ist. In diesem Falle ist das Handelsrecht maßgeblich für das
Steuerrecht.
Daneben gibt es noch andere Gesetze, die von Angehörigen ver-
schiedener Berufs- oder Gewerbegruppen Aufzeichnungspflichten
fordern. Dazu gehören z. B. Bestimmungen aus der Apothekenbe-
triebsordnung, dem Fahrlehrergesetz, der Verordnung über das
Schornsteinfegerwesen, um nur einige zu nennen.
Diese außersteuerlichen Aufzeichnungspflichten, die der Gesetzge-
ber den „Selbstständigen“ abverlangt, gehen weit über die Pflichten
der Buchführung hinaus. Nach § 140 AO sind sie ebenfalls für die
Besteuerung zu erfüllen.
Tipp
Bei Eröffnung eines Betriebes sollten Sie sich stets erkundigen, ob für Ih
ren Berufs oder Gewerbezweig bestimmte außersteuerrechtliche Auf
zeichnungspflichten zu beachten und zu befolgen sind. Auch bei einem
bestehenden Betrieb sollten Sie immer wieder kontrollieren, ob solchen
Aufzeichnungspflichten richtig und vollständig nachgekommen wird.
Doch nicht jeder Selbstständige wird von der Buchführungspflicht
nach Steuerrecht erfasst. Der § 141 AO nennt die folgenden Krite-
A Elementarwissen
12
rien, nach denen Unternehmer der Buchführungspflicht unterliegen
(ab 2004):
● Umsätze von mehr als 350.000 € im Kalenderjahr oder
● selbst bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit
einem Wirtschaftswert von mehr als 25.000 € oder
● Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 30.000 € im Wirt-
schaftsjahr oder
● Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 30.000 € im
Kalenderjahr.
Nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung wird die oben ge-
nannte steuerliche Buchführungspflichtgrenze von bisher 350.000
EUR auf nunmehr 500.000 EUR angehoben werden. Dies sieht der
Entwurf eines Mittelstandentlastungsgesetzes vor, der am 25.4.2006
vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Damit können in Zukunft
viele Unternehmen von der aufwändigen Erstellung eines Jahresab-
schlusses zur Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) wechseln.
Die Einnahmen-Überschussrechnung ist ein beim Finanzamt mit
der Steuererklärung abzugebendes Dokument. Diese Berechnung
stellt im Grundsatz eine einfache Geldverkehrsrechnung dar. Hier
ist vorrangig der Zu- und Abfluss von Einnahmen und Ausgaben
festzuhalten. Das Entstehen einer Zahlungsverpflichtung ist dabei in
der Regel ohne Bedeutung. Das betrifft Zahlungsziele, die zu Forde-
rungen und Verbindlichkeiten führen.
Auch bei der EÜR wird vom Unternehmer verlangt, dem Finanzamt
auf Anforderung die erklärten Betriebseinnahmen zu erläutern und
bei den Betriebsausgaben die Höhe und die betriebliche Veranlas-
sung darzulegen und ggf. glaubhaft zu machen.
Für diese Nachweisführung hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
Aufzeichnungen in Kontoform zu führen, also eine vereinfachte
Buchführung anzulegen. Damit kann der Unternehmer den Über-
blick über die Geschäftstätigkeit behalten und zugleich den Erfor-
dernissen des Finanzamtes Rechnung tragen. Gute, moderne Buch-
führungsprogramme ermöglichen diese vereinfachte Rechnung
neben dem Betriebsvermögensvergleich (Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung).
Kaufmännische Aufzeichnungspflichten A
13
Ergänzend zum Eintragen des Gewinns (Einnahmen-Überschuss) in
die entsprechende Anlage zur Einkommensteuererklärung (mit der
Bezeichnung GSE) genügte in der Vergangenheit eine formfreie
Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben bzw. der entsprechende
Ausdruck einer Einnahmen-Überschussrechnung mit Hilfe des
jeweiligen Buchführungsprogramms. Für nach dem 31.12.2003
beginnende Wirtschaftsjahre muss bei der Einnahmen-Überschuss-
rechnung neben der Steuererklärung eine EÜR nach amtlichem
Vordruck beigefügt werden. Der Vordruck war umstritten, ist heute
aber verpflichtend. Die Standardisierung durch den Vordruck soll
einerseits die Erfüllung der Erklärungspflichten erleichtern, und
andererseits der Finanzverwaltung eine vereinfachte Verprobung
ermöglichen.
Die Anforderungen an die Exaktheit der Aufzeichnungen sind bei
der EÜR keinesfalls geringer als bei den nach Steuerrecht voll buch-
führungspflichtigen Unternehmen. Allerdings – und das spart Ar-
beit in den Unternehmen – müssen an das Finanzamt keine Über-
sichten zu Beständen an materiellen Gütern und Forderungen und
Verbindlichkeiten übergeben werden.
Auch kleinere Unternehmen müssen künftig den Finanzbehörden
ihre Steuerdaten auf elektronischem Wege übermitteln. Damit kön-
nen beim Finanzamt computergestützte Analysen durchgeführt
werden – ähnlich wie bei Jahresabschlüssen der nach Steuerrecht
buchführungspflichtigen Unternehmen. Diese größeren Unterneh-
men sind bereits seit 2002 dazu verpflichtet, die „Grundsätze zum
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“
umzusetzen. So sehen diese GDPdU unter anderem vor, dass an
Steuerprüfer des Finanzamtes auf Anforderung ein Datenträger mit
den steuerrelevanten Daten übergeben werden muss.
Das hat Konsequenzen. Die Steuerprüfer können die Daten mit
ihrer Prüfsoftware IDEA auswerten. Fragen oder Mängel zur Plausi-
bilität innerhalb der Daten fallen sofort auf. Bei den Unternehmern
ist es noch wenig bekannt, in welch hohem Umfang die Finanzäm-
ter bereits Firmendaten zur Verfügung haben oder darauf zugreifen
dürfen.
A Elementarwissen
14
Jeder kann sich allerdings darüber informieren. So sind solche In-
formationen zum Datenzugriff der Finanzbehörden im Internet zu
finden unter www.gdpdu-portal.com.
Dort sind auch weiterführende Links zur Software IDEA vorhanden.
Diese Software ist für jedermann zugänglich. Sie ist also öffentlich
und kein Monopol der Finanzbehörden. Jedem Unternehmer, dem
eine Außenprüfung durch das Finanzamt ins Haus steht, ist zu emp-
fehlen, sich kundig zu machen.
Eine Konsequenz aus diesen hier skizzierten Vorschriften liegt auf
der Hand. In jedem Unternehmen – selbst einer Ich-AG – sollte den
Geschäftsaufzeichnungen eine hohe Priorität beigemessen werden.
Sie müssen mindestens in Form einer einfachen Buchführung, be-
schränkt auf Geldbewegungen, gestaltet werden.
Unabhängig davon jedoch, was beim Finanzamt abzugeben ist,
zeigen alle Erfahrungen, dass der Unternehmer intern eine vollstän-
dige Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
anlegen sollte. Daraus können die Daten für die EÜR entnommen
werden. Diese interne Buchführung auch in kleinen Unternehmen
sichert einen ständigen Überblick über die Geschäftstätigkeit, und
alle Auskunftsbegehren des Finanzamtes können problemlos erfüllt
werden.
Auf einen ebenso häufigen wie schädlichen Irrtum vieler Unter-
nehmer soll an dieser Stelle noch hingewiesen werden. Nicht selten
ist zu hören: „Ich muss von Buchführung nichts verstehen, ich habe
sie von A bis Z dem Steuerberater übertragen. Der richtet alles.“
Die Härte des Geschäftslebens erfordert aber ständigen Überblick
über die Liquidität und verlangt aktuelle Daten, damit gewinnorien-
tierte Entscheidungen getroffen werden können. Der Erfolg eines
Unternehmens wird im Rechnungswesen dokumentiert. Damit
bietet es Informationen für eine erfolgsorientierte Geschäftsentwick-
lung.
Externe Dienstleister übergeben die Buchhaltungsergebnisse jedoch
häufig mit einem Zeitverzug von einem Monat und mehr. Ihre Unter-
nehmensführung basiert dann auf veralteten Informationen. Das darf
Beschaffenheit der Buchführung A
15
und muss nicht eintreten. Die modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien erleichtern es sehr, mindestens Teilarbeiten
für die Buchführung im eigenen Betrieb durchzuführen.
Tipp
Zurück mit kaufmännischen Aufzeichnungen in den Betrieb!
Damit haben Sie nicht nur einen besseren Überblick, sondern spa-
ren dazu noch Geld. Allerdings gehören dazu die Grundkenntnisse,
die Ihnen dieses Buch vermitteln wird.
2 Beschaffenheit der Buchführung
Es ist nicht nur eine uralte Praxis, dass kaufmännische Aufzeich-
nungen angefertigt werden; auch für das „Wie“ gibt es bewährte
Vorgehensweisen. Vor fast 500 Jahren beschrieb Lucas Paciolo, ein
italienischer Mönch, der in der Gegend von Mailand lebte, die Prin-
zipien der Bilanz mit der doppelten Buchführung. Er war mit Leo-
nardo da Vinci befreundet und schrieb auf dessen Anregung hin
eine Abhandlung über den Goldenen Schnitt, welche von Leonardo
da Vinci illustriert wurde. (Anmerkung: Der Film „Da-Vinci-Code“
hat diese Zusammenhänge populär gemacht.)
Paciolos Buch über die Prinzipien der Bilanz stammt aus dem Jahr
1504. Es wird als Grundlage aller seither zu diesem Gebiet geschrie-
benen Lehrbücher betrachtet. Die heutige Buchführung stützt sich
auf Erfahrung und Tradition. Es ist erstaunlich, dass die alten
Grundlagen immer wieder Neues in sich aufnehmen konnten, ohne
die Substanz zu verändern, und sich bis in die heutige Zeit, in der
die manuelle Buchführung fast vollständig durch den Computer
ersetzt wurde, erhalten haben. Das letzte Kapitel dieses Buches bietet
eine Einführung in die Arbeit mit einer Buchführungssoftware.
Dabei wird beispielhaft der lexware buchhalter verwendet.
A Elementarwissen
16
Die seit vielen Jahren bestehende kaufmännische Praxis der Buch-
führung ist Gesetzesinhalt geworden. Das HGB (Handelsgesetz-
buch) und die AO (Abgabenordnung) schreiben nicht nur vor, dass
Kaufleute Bücher führen müssen, sondern sie setzen auch einen
Rahmen dafür, wie das zu geschehen hat. Die entscheidende Vor-
schrift enthält § 238 HGB:
Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverstän-
digen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die
Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln
kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung verfolgen lassen.
Mit diesen Sätzen sind Regelungen von erheblicher Tragweite ge-
troffen.
Wer ist ein „sachverständiger Dritter“? Es ist nicht nur der Finanzbe-
amte, der bei Ihnen im Rahmen einer Außenprüfung die Buchfüh-
rung kontrolliert. Sachverständiger Dritter kann auch ein Familienan-
gehöriger oder Geldgeber sein, der sich anhand Ihrer Geschäftsbücher
davon überzeugen will, dass sein Geld gut angelegt ist.
Einheitliche Richtlinien innerhalb der Buchführung gewährleisten
eine schnelle und inhaltlich klare Verständigung zwischen den je-
weiligen Partnern.
Trotz genauer Regeln ist zugleich ein genügend weiter Rahmen für
die Buchführung gegeben. So kann sie ganz oder auch teilweise „per
Hand” vorgenommen werden. Mit wenigen Ausnahmen wird je-
doch der Computer genutzt. Dafür sind viele Programme im Ange-
bot. Das Buchhaltungsprogramm lexware buchhalter erscheint dem
Autor als das zweckmäßigste Programm am Markt. Als besondere
Qualität des Programms ist zu erwähnen, dass der innere Datei-
Aufbau für den Anwender sehr gut nachvollziehbar ist. Dennoch,
eine gute Software ersetzt keine buchhalterischen Kenntnisse!
Beachten Sie:
Nur derjenige, der per Hand die Grundlagen der Buchführung beherrscht,
kann den Computer als „dienstbaren Geist“ mit Nutzen einsetzen.
Beschaffenheit der Buchführung A
17
Aus den angeführten Überlegungen zum zitierten § 238 HGB ergibt
sich für die betriebliche Praxis, dass nur die doppelte Buchführung
den gesetzlichen Anforderungen genügt. Sie hat sich für die Buch-
führung mit der Hand durchgesetzt und liegt ebenfalls jedem FIBU
(Finanzbuchführungs-)-Computerprogramm zu Grunde. Für den
oben erwähnten lexware buchhalter liegt ein Testat vor, dass die
„Grundsätze der ordnungsmäßigen Speicherbuchführung“ gewahrt
sind. Die Programmphilosophie beinhaltet die traditionellen und
gesetzlich vorgeschriebenen Herangehensweisen.
Wie auch immer im Einzelnen betriebliche Aufzeichnungen gestal-
tet werden, sie müssen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung (GoB) genügen. Die GoB lassen sich in den zwei Grund-
prinzipien Wahrheit und Klarheit zusammenfassen.
Leitsatz:
Wahrheit in der Buchführung bedeutet: Alles muss so gebucht wer
den, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Nichts darf gebucht werden,
was nicht wirklich passiert ist. Scheinbuchungen sind verbotene Fäl
schungen. Klarheit bedeutet: Alles muss übersichtlich, eindeutig, les
bar, nachvollziehbar und geschützt vor Fälschungen sein.
Der erfahrene Kaufmann erkennt aus Ihrer Buchführung sofort, ob
Sie oder Ihre Angestellten gute Arbeit mit Liebe zum Beruf geleistet
haben. Oberflächliche Texte im Journal zum Beispiel, die nur mit
Geistesakrobatik zu deuten sind, führen so gut wie jeden Außenprü-
fer des Finanzamts dazu, den Verdacht zu schöpfen, dass ohne
Nachdenken gearbeitet wurde oder gar etwas vertuscht werden soll.
Er wird sich die Belege zeigen lassen und genauer prüfen.
Eine sich aus der Forderung nach Wahrheit und Klarheit zwingend
ableitende Regel lautet, dass keine Buchung erfolgen darf, ohne dass
ein Beleg vorliegt. Sie sollten sich folgende Grundregel als unab-
dingbar einprägen:
Leitsatz:
Keine Buchung ohne Beleg!
A Elementarwissen
18
Wenn der Beleg nicht aus dem Geschäftsfall direkt entsteht (z. B.
Eingangsrechnung, Quittung), ist ein Eigenbeleg anzufertigen (Ko-
pie der Ausgangsrechnung, Lohnbeleg, Materialentnahmeschein,
Abschreibungsbeleg usw.). Bei der Anfertigung von Eigenbelegen ist
von vornherein zu bedenken, dass sie jeder Revision standhalten
müssen, besonders auch vor dem Finanzamt.
Tipp
Fast jeder Auszubildende in einem kaufmännischen Beruf wird in sei
nen Prüfungen nach den GoB gefragt. Zumeist muss er auch einen Pra
xisbericht anfertigen. Darin ist aufzuzeigen, wie die GoB im Ausbil
dungsbetrieb verwirklicht werden. Die GoB sind ein Regelwerk aus
bewährten praktischen Verfahren und gesetzlichen Anforderungen. Nir
gendwo in Gesetzen oder in der Literatur sind sie einheitlich und all
gemein anerkannt umfassend dargestellt. Für Prüfungen und Berichte
kann folgende Gliederung empfohlen werden. Ausbilder können sie ih
ren Auszubildenden vorgeben. Es kann dann dargestellt werden, dass
die betriebliche Praxis tatsächlich an den Grundsätzen orientiert ist.
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
Organisationsgrundsätze der GoB:
● Jeder Geschäftsvorfall ist in einem Beleg zu erfassen.
● Die Belege sind zeitnah zu erfassen.
● Die Geschäftsvorfälle sind zu systematisieren.
Buchungsgrundsätze der GoB:
Die Buchungen und Aufzeichnungen müssen
● vollständig,
● richtig,
● zeitgerecht,
● geordnet und
● verständlich sein.
Wenn Buchungen und Aufzeichnungen verändert worden sind,
muss das erkennbar sein.
Beschaffenheit der Buchführung A
19
International Financial Reporting Standards (IFRS)/International
Accounting Standards (IAS)
Die Begriffe IFRS und IAS tauchen in den letzten Jahren in der
Fachliteratur zum Rechnungswesen immer häufiger auf. Sie sind
verbunden mit dem Bedürfnis nach internationaler Vergleichbarkeit
der Rechnungslegung. Bereits 1973 wurde das International Ac-
counting Standards Committee (IASC), mit Sitz in London, als
privatrechtlicher Verein nationaler Verbände von Rechnungslegern
und Wirtschaftsprüfern gegründet. Über viele Jahre führte das IASC
ein kaum beachtetes Schattendasein, bis die EU im Jahr 2000 be-
schloss, bei der Fortentwicklung von Rechnungslegungsvorschriften
mit dem IASC zusammenzuarbeiten.
Die neuen Rechnungslegungsstandards heißen nunmehr Internati-
onal Financial Reporting Standards (IFRS); früher wurden sie als
IAS bezeichnet. Der erste neue Standard wurde im Juni 2003 veröf-
fentlicht. Weitere Standards werden laufend verabschiedet. Damit
diese gesetzliche Wirkung entfalten, verabschiedet die Europäische
Union die Standards in einem so genannten Endorsement-Prozess.
Eine Überführung in nationales Recht ist nicht erforderlich, da die
EU-Direktiven unmittelbar für alle Beitrittsländer der Europäischen
Union gelten.
Leser dieses Buches interessieren sich dafür, ob die in Deutschland
gebräuchlichen und vorstehend erläuterten Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung (GoB) durch die IFRS/IAS ersetzt werden.
Die Antwort vorab: Das ist nicht der Fall. Das gilt in erster Linie
dann, wenn die GoB so prinzipiell verstanden werden wie oben
dargestellt (Forderung nach Klarheit und Wahrheit). Die IFRS/IAS
sind keine Buchführungsgrundsätze, sondern Vorschriften für die
Gestaltung der Abschlüsse (nicht formell, sondern bei der Bewer-
tung). Dabei geht es um die Bestimmung des Unternehmensvermö-
gens und des Gewinns. Dieses Bilanzrecht allerdings wird weiter
internationalisiert. Die rund 7.000 börsennotierten Unternehmen in
der EU müssen bereits für Geschäftsjahre, die am oder nach dem
1.1.2005 beginnen, ihre konsolidierten Abschlüsse nach Maßgabe
der IFRS/IAS erstellen.
A Elementarwissen
20
Die wesentlichen Veränderungen, die bei einer Umstellung auf IFRS
zu erwarten sind, lassen sich am besten verstehen, wenn man sich
den grundlegenden Unterschied in der Zielsetzung zwischen deut-
schem Bilanzrecht und IFRS verdeutlicht. Das deutsche Bilanzrecht
ist vom Vorsichtsprinzip geprägt. Im Mittelpunkt stehen die Kapi-
talerhaltung und der Schutz der Gläubiger. Bei den IFRS dominiert
dagegen die Informationsfunktion für Investoren. Dabei steht als
Bild des typischen Investors der anonyme Teilnehmer (z. B. als
Aktionär oder Anleihegläubiger) der organisierten Kapitalmärkte im
Vordergrund. Die wesentliche Anforderung an den Jahresabschluss
ist daher die „fair presentation“, die nicht durch Aspekte der Vor-
sicht und der Risikovorsorge eingeschränkt werden soll. Weitere
Informationen sind im Internet zu erlangen unter www.ifrs-
portal.com
Für die große Mehrheit der deutschen Unternehmen (mittlere und
kleinere) wird es aber vorrangig darauf ankommen, ihre Buchfüh-
rung so zu gestalten, dass sie den Erfordernissen der Steuergesetzge-
bung (Steuerbilanz) entspricht. Wenn sich das Steuerrecht weiter
internationalisiert, werden sich zwangsläufig dann auch die Vor-
schriften zur Ermittlung des Unternehmensvermögens und des
Gewinns den internationalen Standards weiter annähern. Ihre län-
derübergreifende Vereinheitlichung ist Zukunftsperspektive, für die
Termine nicht absehbar sind.
Sehr skeptisch werden die IFRS von Vertretern des Mittelstandes
beurteilt. Am 3. Juli 2006 vertrat der Geschäftsführer des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie (BDI) die Auffassung: „Die inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards IFRS eignen sich in der
jetzigen Form nicht für KMU.“ Einem Mittelständler könne man
das 2.400 Seiten starke Regelwerk nicht zumuten.
Die großen börsennotierten Unternehmen werden in den nächsten
Jahren fast immer zwei Abschlüsse erstellen müssen. Einen nach
deutschem Steuerrecht und einen zweiten nach IFRS. Der Steuerbi-
lanz-Abschluss wird voraussichtlich zumeist weniger günstig ausse-
hen als der IFRS-Abschluss. In diesem Abschluss können die Ver-
mögenswerte und der Unternehmenserfolg im Rahmen der
Die Bilanz im Mittelpunkt der Buchführung A
21
Vorschriften der IFRS so dargestellt werden wie das für die umfas-
sende Information der Investoren eingeschätzt wird.
Wenn auch mittlere und kleinere Unternehmen sich für einen sol-
chen Weg entscheiden, liegt meist die Hoffnung zu Grunde, von
den Banken bei der Kreditwürdigkeit günstiger eingestuft zu wer-
den. Allerdings sind die Mehrkosten für die Erstellung doppelter
Abschlüsse nicht zu unterschätzen. Bezeichnenderweise wurden bei
den kaufmännischen IHK-Prüfungen viele Fragen in Verbindung
mit den GoB und zu Bewertungen nach deutschem Steuerrecht
gestellt. Wir kommen auf die IFRS auf Seite 32 noch einmal zu spre-
chen.
3 Die Bilanz im Mittelpunkt der Buchfüh
rung
Mit den einführenden Betrachtungen in den beiden ersten Kapiteln
haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir uns jetzt
praktisch mit der Buchführung beschäftigen.
Stellen Sie sich vor, Sie gründen ein Unternehmen. Die Größenord-
nung erfordert doppelte Buchführung (laut § 141 AO). Das Finanz-
amt verlangt eine Eröffnungsbilanz. Was schreiben Sie bloß hinein,
wenn Sie noch keine materiellen Gegenstände wie Grundstücke,
Gebäude, Maschinen usw. erworben haben? Gibt es eine Bilanz mit
„Null“? Ganz abstrakt und hypothetisch könnte man von einer
Bilanz mit Null dann sprechen, wenn jemand nur die Idee zu einem
Unternehmensaufbau hat. Praktisch wird allerdings niemand eine
solche Bilanz aufstellen. Ideen werden in der Umsetzung materiali-
siert und führen zu bewertbarem Vermögen, das entweder mit Ei-
gen- oder mit Fremdkapital finanziert wird. Insofern gibt es in der
Praxis keine Bilanz mit einer Summe Null.
Sie werden mindestens ein Kontokorrentgeschäftskonto bei einer
Bank eingerichtet haben. Die Höhe des Guthabens geht aus dem
Kontoauszug hervor. Die andere Frage ist aber, wie Sie das Geld
beschafft, Ihr Unternehmen also finanziert haben. Wenn es Ihnen
A Elementarwissen
22
gelungen ist, ohne Fremdkapital auszukommen, kann Ihre Eröff-
nungsbilanz folgendermaßen aussehen, wobei alle Angaben in der
Währung € (Euro) erfolgten:
Ingenieurbüro Felix Schlau
Aktiva
Bilanz zum 01.01.200X
Passiva
Bank 50.000,00 Eigenkapital 50.000,00
Glückstadt, den 01.01.200X
Felix Schlau
X steht für das Jahr der Unternehmensgründung
Hätte Felix Schlau anstelle der vollen Eigenkapitalfinanzierung ein
Darlehen aufgenommen, hätte die rechte Seite, die Passiv-Seite der
Bilanz, einen anderen Inhalt:
Ingenieurbüro Felix Schlau
Aktiva
Bilanz zum 01.01.200X
Passiva
Bank 50.000,00 Eigenkapital 35.000,00
Darlehen 15.000,00
50.000,00 50.000,00
Glückstadt, den 01.01.200X
Felix Schlau
X steht für das Jahr der Unternehmensgründung
Aus diesen ganz einfachen Darstellungen erkennen Sie ein wesentli-
ches Grundprinzip:
Leitsatz:
Jede Bilanz hat zwei Seiten.
Die linke Seite enthält die Aktiva, die Positionen der rechten Seite
werden als Passiva bezeichnet.
Jede Bilanz ist ausgeglichen – Aktiva und Passiva sind wertmäßig
immer gleich.
Die Bilanz im Mittelpunkt der Buchführung A
23
Für diesen Grundsatz gibt es gute Gründe. Die oben dargestellten
zwei Bilanzen zeigen, dass Sie nur einen Teil der Wahrheit auswei-
sen würden, wenn Sie es bei der Information belassen, dass Ihr
Bankkonto ein Guthaben von 50.000 € ausweist. Ihre Geschäftslage
wird erst dann deutlich, wenn der Leser Ihrer Bilanz sieht, ob die
50.000 € von Ihnen als Unternehmer selbst aufgebracht wurden,
oder ob ein Teil davon geborgt ist, also fremdes Kapital darstellt.
Einerseits hat ein Unternehmen bestimmte Vermögenswerte im Be-
sitz, es kann also aktiv darüber verfügen. Das können Grundstücke
sein, Maschinen, Rohstoffe, Außenstände (Forderungen), Bargeld,
Guthaben auf Girokonten. Andererseits müssen alle diese Vermö-
genswerte finanziert sein – durch eigenes oder durch fremdes Kapital.
Leitsatz:
Die Darstellung der Vermögenswerte – der Aktiva – einerseits und
die Darstellung der Finanzierung – der Passiva – andererseits – das
ist Ausgangspunkt der doppelten Buchführung.
Damit haben Sie den Schlüssel zum Verständnis für das Prinzip der
doppelten Buchführung. Scherzbolde behaupten ja, sie sei doppelt,
weil es eine Buchführung für das Finanzamt gibt und eine andere
mit der Wahrheit – das ist natürlich nicht so.
Sie werden erkannt haben, dass die Bilanz Gleichungen enthält:
Aktiva = Eigenkapital + Fremdkapital
Eigenkapital = Aktiva – Fremdkapital
Fremdkapital = Aktiva – Eigenkapital
Selbst dann, wenn die Schulden noch so hoch sein sollten, gilt: Die
Bilanz ist immer ausgeglichen. Als Möchtegernkaufmann entlarvt
sich jemand, der von einer nicht ausgeglichenen Bilanz spricht. So
etwas gibt es nicht, das wissen Sie nun.
A Elementarwissen
24
Wie können Sie sich die Begriffe „Aktiva“ und „Passiva“ erklären?
Aktiva sind solche Vermögensformen, die Sie als Unternehmer „ak-
tiv“ einsetzen können, unabhängig davon, ob Sie diese selbst finan-
ziert haben oder nicht. Die Passivseite zeigt die Finanzierung, also
die Herkunft des Kapitals. Der Kapitalgeber kann die Richtung der
Geschäftstätigkeit mitbestimmen, im Vergleich zum Geschäftsführer
verkörpert er aber dennoch die passive Seite.
Aussage der beiden Seiten der Bilanz
Aktiva Passiva
Formen des Vermögens.
Wie wurde investiert?
Wie wurden die Mittel eingesetzt?
Herkunft, Quellen der Finanzierung.
Wie wurde finanziert?
Woher stammen die Mittel?
Sie stoßen bei der Aufstellung Ihrer Bilanz vermutlich auf ein weite-
res Problem, und das besonders dann, wenn Sie außer über Ihr
Bankguthaben noch über weitere Vermögensteile verfügen. In wel-
cher Detailliertheit müssen Sie diese aufführen – vielleicht gar ein-
zeln nach Art, Menge und Wert? Glücklicherweise ist das nicht der
Fall. Sie können Gruppierungen vornehmen und bestimmte Bilanz-
positionen bilden. Früher war die Detailliertheit der Bilanz dem
Kaufmann überlassen – später hatte sich eine Art allgemeiner, ge-
sellschaftlicher Übereinkunft herausgebildet.
Jetzt wird auch das durch ein Gesetz geregelt. Es handelt sich um
den § 266, Ziffer 2 des Handelsgesetzbuches (HGB). Die dort ent-
haltene Bilanzgliederung sollten Sie sich jetzt anschauen. Sie ist zwar
nur für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften vorgeschrieben.
In der Praxis hat sich diese Gliederung aber auch für Personenge-
sellschaften durchgesetzt, wobei häufig die Positionen noch weiter
zusammengefasst werden. Sie sollten aber darauf achten, dass Ihre
Bilanz durch eine zu starke Aggregation einzelner Positionen nicht
ihren Aussagewert verliert.