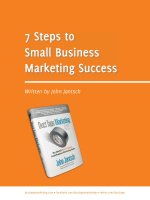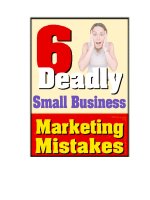Business to business marketing
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.08 MB, 274 trang )
Axel Gawantka
Anbieterzufriedenheit in industriellen Geschaftsbeziehungen
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Business-to Business-Marketing
Herausgeber:
Professor Dr. Dr. h.c. Werner Hans Engelhardt,
Universitat Bochum,
Professor Dr. Michael Kleinaltenkamp,
Freie Universitat Berlin (schriftfiihrend)
Herausgeberbeirat:
Professor Dr. Dr. h.c. Klaus Backhaus, Universitat Miinster,
Professor Dr. Joachim Buschken,
Katholische Universitat Eichstatt-ingolstadt,
Professorin Dr. Sabine FlieU, Fernuniversitat Hagen,
Professor Dr. Jorg Freiling, Universitat Bremen,
Professor Dr. Bernd GiJnter, Universitat Diisseldorf,
Professor Dr. Frank Jacob,
ESCP-EAP Europaische Wirtschaftshochschule Berlin,
Professor Dr. Wulff Plinke, Humboldt-Universitat zu Berlin,
Professor Dr. Martin Reckenfelderbaumer,
Wissenschaftliche Hochschule Lahr/AKAD Hochschule fur
Berufstatige, Lahr/Schwarzwald,
Professor Dr. Mario Rose, Universitat Bochum,
Professor Dr. Albrecht Sollner, Europa-Universitat Viadrina
Frankfurt/Oder,
Professor Dr. Markus Voeth, Universitat Hohenheim,
Professor Dr. Rolf Weiber, Universitat Trier
Das Business-to-Business-Marketing ist ein noch relativ junger Forschungszweig, der in Wissenschaft und Praxis standig an Bedeutung
gewinnt. Die Schriftenreihe mochte dieser Entwicklung Rechnung tragen und ein Forum fur wissenschaftliche Beitrage aus dem Businessto-Business-Bereich schaffen. In der Reihe sollen aktuelle Forschungsergebnisse prasentiert und zur Diskussion gestellt werden.
Axel Gawantka
Anbieterzufriedenheit
in industriellen
Geschaftsbeziehungen
Das Beispiel Automobilindustrie
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Markus Voeth
Deutscher Universitats-Verlag
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet iiber <> abrufbar.
Dissertation Universitat Hohenheim, 2006
D100
1. Auflage Juni2006
Alle Rechte vorbehaiten
© Deutscher Universitats-Verlag I 6WV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006
Lektorat: Brigitte Siege! / Sabine Scholler
Der Deutsche Universitats-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media,
www.duv.de
Das Werk einschlieSlich aller seiner Telle ist urheberrechtlich geschiitzt.
Jede Verwertung aul^erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulassig und strafbar. Das gilt insbesondere fiir Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und dahervon jedermann benutzt werden diJrften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
Druck und Buchbinder: Rosch-Buch, ScheBlitz
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN-10 3-8350-0417-4
ISBN-13 978-3-8350-0417-7
Geleitwort
Die zunehmende Austauschbarkeit der von Wettbewerbem angebotenen Leistungen fiihrt in
vielen industriellen Markten dazu, dass Anbieter entweder zu einen Preiswettbewerb
gezwungen warden, weil Nachfrager ihre Kaufentscheidung allein anhand der geforderten
Gegenleistung treffen, oder aber den Versuch untemehmen miissen, sich durch produktpolitische MaBnahmen vom Wettbewerb zu differenzieren. Neben dem Angebot produktbegleitender Dienstleistungen kommt in diesem Zusammenhang gerade der Leistungsindividualisierung eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Angebot einer genau auf die individuellen
Nachfragerbediirfnisse zugeschnittenen Leistung gehen allerdings auch fiir die Nachfrager
grundsatzliche Veranderungen der Geschaftsbeziehungen einher. Indem sie Anbieter liber ihre
speziellen Anforderungen und Bediirfhisse in Kenntnis setzen und ihre intemen Prozesse auf
die von den Anbietem angebotenen individuahsierten Leistungen ausrichten, gehen sie eine in
vielen Fallen nicht unerhebliche Bindung an den zuvor augewahlten Anbieter ein. Mit
anderen Worten ist die seitens des Anbieters offerierte Leistungsindividualisierung auch fiir
den Nachfrager mit spezifischen Investitionen verbunden.
Vor diesem Hintergrund ist es zunachst fiir den Anbieter der Leistung entscheidend, die mit
dem Nachfrager eingegangene Geschaftsbeziehung so zu steuem, dass dieser ein hohes,
zumindest aber ein ausreichendes MaB an Zufriedenheit aufweist. Denn nur so wird der
Nachfrager bereit sein, die Geschaftsbeziehung fortzufiihren oder diese langfristig zu
intensivieren. Unter den Begriffen Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Kundenloyalitat wird diese Thematik auch im Zusammenhang mit Ijidustriegiitem bis heute ausfuhrlich
diskutiert. Dariiber hinaus kommt aber auch der Zufriedenheit des Anbieters in einer solchen
Marktsituation eine zentrale Bedeutung fiir die Fortfiihrung und Steuerung der Geschaftsbeziehung zu. Auf der einen Seite stellt das Konstrukt der Anbieterzufriedenheit fiir den
Nachfrager eine wichtige SteuerungsgroBe dar, da eine Beendigung der Geschaftsbeziehung
durch den Anbieter den Verlust der nachfragerseitigen spezifischen Investitionen zufolge
haben wiirde. Daher muss es im Interesse des Nachfragers liegen, die Anbieterzufriedenheit
sicher zu stellen.
SchlieBlich stellt die Messung und Analyse der eigenen Zufriedenheit aber auch fiir den
Anbieter eine wesentliche GroBe dar. So muss dieser permanent in der Geschaftsbeziehung
priifen, ob eine Fortfiihrung derselbigen fiir ihn noch okonomisch sinnvoll ist.
Trotz der offensichtlichen Bedeutung des Themas „Anbieterzufriedenheit" ist umso
uberraschender, dass dieses Thema in der Literatur bislang noch nicht umfassend beleuchtet
worden ist. Genau dies leistet die vorliegende Arbeit. In ihr wird nicht nur das im Mittelpunkt
stehende Konstrukt grundlegend fundiert. Vielmehr geht der Verfasser dariiber hinaus auch
theoretisch und empirisch der Frage nach, durch welche Einflussfaktoren die Anbieterzufrie-
denheit gepragt wird, so dass im Anschluss Handlungsimplikationen abgeleitet werden
konnen. Dabei nimmt der Verfasser eine spezifische Perspektive ein: er analysiert das Thema
aus Sicht des Anbieters. Als Referenzbranche dient ihm dabei die Automobilzuliefererindustrie, in der die Anbieterzufriedenheit bedingt durch die Branchencharakteristika von
besonderem Gewicht ist.
Angesichts des Innovationsgrades des Themas, der fundierten Bearbeitung und der
interessanten empirischen Ergebnisse wtinsche ich der Arbeit, dass sie in Wissenschaft und
Praxis besondere Beachtung finden wird.
Prof. Dr. Markus Voeth
VI
Vorwort
Entstanden ist die vorliegende Arbeit wahrend meiner Tatigkeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl fiir Marketing der Universitat Hohenheim. Sie wurde von der
Fakultat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Wintersemster 2005/2006 als Dissertation
angenommen. Wahrend meiner Zeit als Lehrstuhlmitarbeiter und Doktorand haben mich viele
Personen unterstiitzt, denen ich an dieser Stelle danken mochte.
GroBer Dank geblihrt so zunachst meinem akademischen Lehrer, Herm Prof. Dr. Markus
Voeth. Er hat daflir gesorgt, dass trotz der zwischenzeitlichen durch Umzug und Themenwechsel bedingten Irritationen weder der Mitarbeiter- noch der Anbieterzufriedenheit
Schaden zukam. Prof. Voeth hat durch seine Ideen und seine stete Diskussionsbereitschaft
maBgeblich zum erfolgreichen Abschluss des Projektes „Dissertation" beigetragen. Danken
mochte ich ihm auch fiir die Gelegenheit, im lehrstuhleigenem „Dissertationskammerlein"
eine Zeit lang zwar weniger aktiv am Lehrstuhlleben teilhaben zu konnen, andererseits aber
die Arbeit ein entscheidendes Stiick voranzubringen. SchlieBlich hat die sehr schnelle
Begutachtung dazu gefuhrt, die Dissertation auch in zeitlicher Hinsicht wunschgemaB fertig
stellen zu konnen. Frau Prof. Dr. Mareike Schoop danke ich recht herzlich fur die Ubemahme
des Zweitgutachtens, die ebenfalls zeitnahe Begutachtung, die hilfreichen Anmerkungen und
Hinweise sowie die interessante Zeit als Mitarbeiter des Competence Centers industrielle
Dienstleistungen (CCiD) an der Universitat Hohenheim. Herm Prof Dr. Helmut Kuhnle
danke ich fur die Ubemahme des miindlichen Priifungsvorsitzes und die angenehme
Priifungsatmosphare.
GroBen Dank aussprechen mochte ich auch meinen Kollegen am Lehrstuhl fiir Marketing der
Universitat Hohenheim: Zunachst danke ich Herm Dr. Marcus Liehr. Dass unser noch aus
Duisburger Zeiten stammender Kontakt nie abgerissen ist und dass er mir wahrend der
Leidenszeit des „Dissertierens" sowohl in fachlicher wie in personlicher Hinsicht beigestanden hat, hat mich stets sehr gefreut. Danken mochte ich auch Frau Dr. Kerstin Liehr-Gobbers:
Ohne ihre Hilfe in PLS-Fragen wiirde ich wohl immer noch an der Fertigstellung der Arbeit
werkeln. Die Zeit im Schwabenland halfen mir vor allem meine „Kollegen vor Ort" als
angenehme in Erinnemng zu behalten: Einen besonders langen Zeitabschnitt durfle ich dabei
Frau Prof Dr. Christina Sichtmann, Herm Dr. Dominik Wagemann sowie Herm Dipl.-Kfm.
Stefan Sandulescu zu meinen Kollegen und Freunden zahlen. Wahrend letztere „Funktion"
hoffentlich auch zukiinftig bestehen bleibt, mochte ich mich hier ganz herzlich sowohl fiir die
stete Hilfsbereitschaft im Hinblick auf die Arbeit als auch fiir die zahlreichen gemeinsam
verbrachten Stunden in der Freizeit bedanken. Frau Dr. Renate WeiBbacher mochte ich wie
Herm Dipl.-Kfm. Jorg Brinkmann und Frau Dipl. rer. com. Uta Herbst ganz herzlich fiir ihre
hilfreichen Anregungen und Anmerkungen danken. Mein Dank gilt auch der nachsten
VII
„Lehrstuhlmitarbeiter-Generation": Frau Dipl. oec. Isabel Tobies, die mich bereits als
studentische Hilfskraft bei Recherchen zum Dissertationsthema unterstiitzt hat, sowie Herr
Dipl.-Kfm. Christian Niederauer und Herr Dipl. oec. Christoph Sandstede haben das Team
verstarkt und dazu beigetragen, dass ich die Fertigstellung der Dissertation auch zeitlich wie
erhofft bewaltigen konnte.
Fur Ihre stete Unterstutzung und das eine oder andere aufmuntemde Wort will ich auch den
beiden „guten Seelen" des Lehrstuhls, Frau Monika Fielk und Frau Herta Gehrung danken.
SchlieBlich gilt mein Dank Frau Dipl. rer. com. Sina Barisch fiir die Unterstutzung bei der
Datenerhebung und gemeinsam durchlittene empirische Durststrecken sowie Frau Dipl. oec.
Steffi Balbach, die beim Korrekturlesen der Arbeit eine wichtige Unterstutzung war.
Als mindestens ebenso wichtig wie die unmittelbare Begleitung bei der Erstellung der Arbeit
envies sich die mittelbare: Neben meinen Freunden, die mich durch Doppelkopf-Runden und
andere Aktivitaten auch an Zufriedenheiten jenseits der industriellen denken lieBen, mochte
ich vor allem meinen Eltem Monika und Armin Gawantka danken. Die liebevolle Unterstutzung, die sie mir jederzeit zukommen lieBen, hat es mir erst ermoglicht, die Dissertation
erfolgreich abzuschlieBen und dabei nicht zu vergessen, dass es auch ein Leben neben der
Arbeit gibt. In letzterem spielt meine Freundin Anja Kipinski eine nicht ganz unwichtige
RoUe. Sie musste sich oft Geschichten uber die verschiedenartigsten Probleme anhoren.
Dafur, dass Du immer fiir mich da warst und mir schlieBlich geholfen hast, die Zeit als
wissenschaftlicher Mitarbeiter gut zu iiberstehen und immer optimistisch in die Zukunft zu
schauen, vielen lieben Dank. Meinen Eltem und Anja ist diese Arbeit gewidmet.
Axel Gawantka
VIII
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
IX
Abbildungsverzeichnis
XIII
Tabellenverzeichnis
XV
Abkiirzungsverzeichnis
XVII
A. Einleitung
1
1.
Eine einfuhrende Fallstudie
1
2.
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
7
B. Anbieterzufriedenheit als relevantes Konstrukt bei der Beurteilung industrieller
Geschaftsbeziehungen
9
1.
9
Anbieterzufriedenheit: Eine Begriffskonkretisierung
1.1
Abgrenzung von anderen okonomischen Zufriedenheitsbegriffen
1.2
Einflussfaktoren auf die Relevanz der Anbieterzufriedenheit
13
1.2.1
Objekt der Austauschbeziehung
13
1.2.2
Transaktionsebene: Einzeltransaktion versus
Geschaftsbeziehung
21
Konsequenz fiir die bereichsspezifische Relevanz
28
1.2.3
1.3
Besonderheiten der Anbieterzufriedenheit im industriellen
Satisfaction Center
1.3.1
1.3.2
2.
9
31
Individuen versus Personengruppen als Trager der
Zufriedenheit
31
Entstehungsprozess der Anbieterzufriedenheit
37
Die Transaktionskostentheorie als Ansatz zur Untersuchung der
Zufriedenheit von Anbietem in Geschaftsbeziehungen
2.1
43
Ableitung einer geeigneten Theorie
43
2.2
Grundlagen der Transaktionskostentheorie
51
2.3
Erklarung marktlicher Koordinationsformen durch die
Transaktionskostentheorie
55
IX
3.
Der Erklarungsbeitrag der Transaktionskostentheorie fiir die
Zufriedenheit von Anbietem in Geschaftsbeziehungen
3.1
Relevante transaktionskostentheoretische Attribute
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.2
59
Wechselkosten als Konsequenz spezifischer Investitionen
61
64
Folgen opportunistischer Verhaltensweisen des Nachfragers
bei der Integration in den Leistungserstellungsprozess
68
3.2.1.1
Integrationsbewusstsein
71
3.2.1.2
Integrationsbereitschaft
72
3.2.1.3
Integrationsfahigkeit
73
3.2.1.4
Interaktionsbereitschaft und -fahigkeit
74
Folgen der Bindung des Anbieters an den Nachfrager durch
spezifische Investitionen
76
3.3
Konsequenzen der Unzufriedenheit des Anbieters
79
3.4
Inhaltliche Abgrenzung der relevanten Konstrukte
80
3.4.1
Einfluss durch die Integrationsleistung des Nachfragers
81
3.4.1.1
Integrationsfahigkeit
81
3.4.1.2
Integrationsbereitschaft
84
3.4.1.3
Interaktionsfahigkeit
85
3.4.1.4
Interaktionsbereitschaft
87
3.4.2
3.4.3
3.5
X
59
Unsicherheit des Anbieters und Opportunismus des
Nachfragers
Wirkung der Attribute aus Anbietersicht
3.2.1
59
Einfluss der moglichen Ausbeutung durch den Nachfrager
88
3.4.2.1
Verteilungsgerechtigkeit
88
3.4.2.2
Flexibilitat
90
3.4.2.3
Beziehungsinteresse
91
3.4.2.4
Abhangigkeit
92
Beeinflusste Konstrukte
94
3.4.3.1
Anbieterzufriedenheit
94
3.4.3.2
Beziehungserfolg
96
Dimensionalitat und Modellspezifikation
98
C. Theoretische Grundlagen der empirischen Untersuchung
102
1.
Zielsetzung und Vorgehen
102
2.
Grundlegende Methodik: Strukturgleichungsmodelle als Analysemethode
103
2.1
Datenanalyse mit Strukturgleichungsmodellen
103
2.2
Vergleich der Ansatze zur Analyse von
Strukturgleichungsmodellen
110
2.2.1
Theoretischer Vergleich von LISREL und PLS
110
2.2.2
Vergleich im Hinblick auf das Untersuchungsobjekt der
Arbeit
115
2.3
3.
Der PLS-Schatzalgorithmus
Operationalisierung des Modells
3.1.
3.2
3.3
118
124
Operationalisierung der latenten exogenen Variablen
124
3.1.1
Integrationsfahigkeit
124
3.1.2
Integrationsbereitschaft
127
3.1.3
Interaktionsfahigkeit
129
3.1.4
Interaktionsbereitschaft
131
3.1.5
Verteilungsgerechtigkeit
132
3.1.6
Flexibilitat
134
3.1.7
Beziehungsinteresse
135
3.1.8
Abhangigkeit
136
Operationalisierung der latenten endogenen Variablen
139
3.2.1
Anbieterzufriedenheit
139
3.2.2
Beziehungserfolg
140
Darstellung des vollstandigen Modells
141
D. Empirische Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Anbieterzufriedenheit
144
1.
144
Grundlagen der empirischen Untersuchung
1.1
Untersuchungsgegenstand
144
1.1.1
Auswahl einer geeigneten Branche
144
1.1.2
Ansatz zur Ermittlung der Anbieterzufriedenheit im
Satisfaction Center
145
XI
2.
1.2
Untersuchungsvorgehen
148
1.3
Bereinigung des Datensatzes
151
1.4
Charakteristika der Stichprobe
152
GutemaBe und Ergebnisbeurteilung
2.1
2.2
3.
4.
Guteiiberpriifung der Messmodelle
159
2.1.1
Reflektive Messmodelle
159
2.1.2
Formative Messmodelle
170
Guteuberpriifung des Strukturmodells
Priifung der Hypothesen
3.1
158
174
181
Einfluss der Determinanten auf die Anbieterzufriedenheit
181
3.1.1
Integrationsfahigkeit
181
3.1.2
Integrationsbereitschaft
182
3.1.3
Interaktionsfahigkeit
183
3.1.4
Interaktionsbereitschaft
184
3.1.5
Verteilungsgerechtigkeit
185
3.1.6
Flexibilitat
186
3.1.7
Beziehungsinteresse
186
3.1.8
Abhangigkeit
187
3.2
Einfluss der Anbieterzufriedenheit auf den Beziehungserfolg
189
3.3
Beurteilung des Gesamtmodells
190
Marketingimplikationen der Ergebnisse
193
£. Schlussbetrachtung und Ausblick
200
Anhang
205
Literaturverzeichnis
223
XII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Abgrenzung okonomischer Zufriedenheitsarten
12
Abbildung 2: Leistungserstellungsprozess unter der Integration des Kunden
15
Abbildung 3: Transaktionsebenen und Zusammenhange
22
Abbildung 4: Relative Verteilung spezifischer Investitionen
26
Abbildung 5: Geschaftstypenansatz nach Backhaus (2003) und Relevanz der
Anbieterzufriedenheit
28
Abbildung 6: Einflussfaktoren auf das Satisfaction Center
33
Abbildung 7: Beziehungen im Satisfaction Center
36
Abbildung 8: Verhaltensunsicherheiten und Informationsasymmetrien
60
Abbildung 9: Verteilung der Quasirente, Lock-In und Ausstieg bei Ausbeutung
63
Abbildung 10: Transaktionskostenarten mit Auswirkungen auf die
Anbieterzufriedenheit
65
Abbildung 11: Potenzielle Auswirkungen der Theorieattribute in der Praxis
67
Abbildung 12: Einflussfaktoren auf die Integrationsunsicherheit des Anbieters
71
Abbildung 13: Folgen der Bindung des Anbieters an den Nachfrager
77
Abbildung 14: Dimensionalitat von Konstrukten
98
Abbildung 15: Uberblick iiber die Hypothesen im Hinblick auf die Determinanten der
Anbieterzufriedenheit
Abbildung 16: Vorlaufiges Modell zur Erlauterung der Einflusse auf die bzw. der
Anbieterzufriedenheit
100
101
Abbildung 17: Vorgehen zur Konzeption und Analyse eines Strukturgleichungsmodells... 103
Abbildung 18: Vollstandiges Kausalmodell
104
Abbildung 19: Mode A, Mode B und Mode C als Auspragungen von Beziehungen
zwischen Variablen und Indikatoren
106
Abbildung 20: Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC)-Modell
114
Abbildung 21: Bestandteile und Ablauf des PLS-Schatzalgorithmus
119
Abbildung 22: Vollstandiges Strukturgleichungsmodell „Anbieterzufriedenheit" mit
Messmodellen
Abbildung 23: Umsatzanteile in der Automobilindustrie bei Tier 1- und Tier XZulieferem
142
155
XIII
Abbildung 24: Bisherige Dauer der Geschaftsbeziehung
156
Abbildung 25: Kooperationsbereiche in den Geschaftsbeziehungen von Tier 1- und
Tier X-Zulieferem
156
Abbildung 26: Hohe und Signifikanz der Pfadkoeffizienten im Strukturmodell
175
Abbildung 27: Teilmodell mit fiir die Anbieterzufriedenheit relevanten Determinanten
194
Abbildung 28: Reduziertes Strukturgleichungsmodell zur Anbieterzufriedenheit
197
Abbildung 29: Vorgehen zur Problemerkennung bzw. -losung
199
XIV
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Opportunismusformen in der Transaktionskostentheorie
53
Tabelle 2:
Auspragungen des nachfragerseitigen Opportunismus
75
Tabelle 3:
Vergleich von PLS-und LISREL-Ansatz
115
Tabelle 4:
Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Integrationsfahigkeit"
126
Tabelle 5:
Tabelle 6:
Tabelle 7:
Tabelle 8:
Tabelle 9:
Priifung der Art des kausalen Zusammenhangs zwischen den Indikatoren
und der latenten Variable Integrationsfahigkeit
127
Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Integrationsbereitschaft"
128
Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Interaktionsfahigkeit"
130
Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Interaktionsbereitschaft"
132
Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Verteilungsgerechtigkeit"
133
Tabelle 10: Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Flexibilitat"
134
Tabelle 11: Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Beziehungsinteresse"
136
Tabelle 12: Multi-Item-Skala zur Messung der latenten exogenen Variable
„Abhangigkeit"
138
Tabelle 13: Multi-Item-Skala zur Messung der latenten endogenen Variable
„Anbieterzufriedenheit"
140
Tabelle 14: Multi-Item-Skala zur Messung der latenten endogenen Variable
„Beziehungserfolg"
141
Tabelle 15: Ergebnisse der Faktorenanalyse zur Ermittlung der Dimensionsanzahl der
Konstrukte
162
Tabelle 16: Indikatorreliablitat der reflektiven Indikatoren
163
Tabelle 17: Bootstrapping-Ergebnisse fiirdie auBeren Ladungen
165
Tabelle 18: Cronbachs Alpha als GutemaB fiir die interne Konsistenz
167
Tabelle 19: Interne Konsistenz als GutemaB fiir die Konstruktreliabilitat
168
XV
Tabelle 20: Durchschnittliche erfasste Varianz als GiitemaB flir die
Diskriminanzvaliditat
169
Tabelle 21: Quadrierte Korrelationen der latenten Variablen
170
Tabelle 22: Variance Inflation Index-Werte zur Feststellung von Multikollinearitat der
formativen Indikatoren
174
Tabelle 23: Effektstarke f^ als BeurteilungsmaB zur Starke des Einflusses der latenten
exogenen Variablen
176
Tabelle 24: Ergebnisse der Blindfolding-Prozedur und zur Prognoserelevanz Q^
180
Tabelle 25
Ergebnisse der Hypothesenpriifung des Gesamtmodells
192
Tabelle 26
Einfaches Scoring-Modell zur Identifikation von Ursachen einer
optimierungsfahigen Anbieterzufriedenheit
198
XVI
Abkiirzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
ADF
Asymptotically Distribution-Free
AMOS
Analysis of Moment Structures
ANZ
Anbieterzufriedenheit
BIN
Beziehungsinteresse
bzw.
beziehungsweise
DEV
durchschnittlich erfasste Varianz
d.h.
das heiBt
etal.
et alii
f.
folgende Seite
ff.
fortfolgende Seiten
F&E
Forschung und Entwicklung
FLX
Flexibilitat
i. e. S.
im engeren Sinn
lAB
Interaktionsbereitschaft
lAF
Interaktionsfahigkeit
IGB
Integrationsbereitschaft
i. w. S.
im weiteren Sinn
LISREL
Linear Structural Relationships
MIMIC
Multiple Indicators and Multiple Causes
OEM
Original Equipment Manufacturer
PC
Personal Computer
PLS
Partial Least Squares
Tab.
Tabelle
usw.
und so weiter
u.v.a.
und viele andere
VDA
Verband der Automobilindustrie
vgl.
vergleiche
XVII
VGK
Verteilungsgerechtigkeit
VIF
Variance Inflation Factor
z. B.
zum Beispiel
z. T.
zum Teil
XVIII
A.
Einleitung
1.
Eine einfiihrende Fallstudie
In industriellen Geschaftsbeziehungen spielt nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondem auch
die Zufriedenheit des Anbieters im Hinblick auf eine fur beide Seiten zielflihrende
Fortsetzung der Geschaftsbeziehung eine zentrale Rolle. Dies soil am Beispiel einer
einfiihrenden verfremdeten Fallstudie aus der Automobilindustrie verdeutlicht werden.
Die Kirchhellner AG wurde kurz nach dem Ende des 1. Weltkriegs im Jahr 1919 gegrUndet.
Am 23. Januar wurde eine entsprechende Eintragung in das Handelsregister der Stadt Stuttgart vollzogen. Ihr ist zu entnehmen, dass der Gegenstand des Unternehmens die Herstellung
von Zahnrddern, Bremsapparaturen und Beleuchtungsanlagen fur nicht-motorisierte und motorisierte Personen- und Frachtbeforderungsmittel gewesen ist. Die Kirchhellner AG erwarb
sick im Laufe der Zeit durch ihre Prdzisionsarbeit einen exzellenten Ruf als Zulieferer fur
Automobil- und Flugzeughersteller. 1928 wurde die erste Transaktion mit den Kraftwagenwerken (KWW) vollzogen, die von der Kirchhellner AG fur ihren Sportwagen „ Super Sport
Kompressor" Telle des den Motor aufladenden Kompressors sowie das Getriebe bezogen.
Hauptabnehmer der Kirchhellner AG waren aber immer noch Flugzeughersteller aus dem
europdischen Raum.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gewdhrten die Alliierten der Kirchhellner AG 1948 die Genehmigung zur Produktion von Getrieben, Beleuchtungsanlagen und sonstigem elektrischen Zubehorfur Automobile. Die KWW traten daraufhin erneut mit der Kirchhellner AG in Verhandlungen und beschlossen im Anschluss hieran,fur den ersten nach dem Zweiten Weltkrieg komplett neu konstruierten KWW-PKW die Beleuchtungsanlagen und das Getriebe von diesem
Zulieferer zu beziehen. Dies war der Beginn einer langandauernden Geschaftsbeziehung, die
noch immer jfbrtbesteht. Dabei wurden die Vertrdge zwischen Zulieferer und Hersteller im
Regelfall ilber die Dauer des Lebenszyklusses eines PKW-Modells geschlossen. Da es der
Kirchhellner AG seit 1949 stetig gelang, von KWW als Zulieferer fUr mindestens eine der aktuellen Baureihen ausgewdhlt zu werden, bestand die Geschdftsbeziehung zwar aus zahlreichen (sich zum Teil iiberschneidenden) Episoden, war aber aus Sicht des Unternehmensvorstandes als kontinuierliche Beziehung zu betrachten. Wdhrend der einzelnen Episoden wurdeseit einigen Jahren regelmdfiig durch den Zulieferer die Zufriedenheit des Automobilherstellers erhoben. Zwar stand die Produktqualitdt bei den Zufriedenheitsbefragungen stets im Mittelpunkt, aber auch andere Aspekte (Piinktlichkeit der Lieferungen, Hoflichkeit der Mitarbeiter etc.) wurden betrachtet und analysiert. Regelmdfiig wurden diese Ergebnisse sowohl den
eigenen Mitarbeitern als auch der KWW als Kunden zugdnglich gemacht. Dieses Prozedere
hatte sich in den vergangenen Jahren bewdhrt und wurde von den MarketingVerantwortlichen der Kirchhellner AG in Zusammenarbeit mit der KWW stetig weiter entwickelt.
Im Zeitablauf hatte sich die Kirchhellner AG nicht zuletzt wegen der hohen Kundenzufriedenheit zu einem der wichtigsten Zulieferer von KWW entwickelt. Neben den klassischen Produk-
ten wie Getrieben und Beleuchtungsanlagen wurden die Kernkompetenzen um die ein immer
starkeres Gewicht einnehmenden Bereiche Sicherheit (Airbags, Uberrollsensoren usw.) und
Elektronische Fahrhilfen (ESP, ABS etc.) erweitert.
Mehr als 60 Prozent der Wertschopfung der von KWW hergestellten Fahrzeuge wurden inzwischen von den Zulieferern erbracht, bei manchen so genannten Nischenmodellen wie Cabrios oder Geldndewagen lag dieser Anteil sogar noch wesentlich hoher. Bei sdmtlichen Teilen
und Komponenten, die von der Kirchhellner AGfUr KWW entwickelt wurden, handelte es sich
um individuelle Anfertigungen, die nurfiir die PKWs dieses Herstellers geeignet waren und
somit eine hohe Spezifitdt aufwiesen. Die Kirchhellner AG leistete dabei in hohem Mafi Entwicklungsarbeit flir KWW, da zahlreiche Neuerungen, die beispielsweise sicherheitsrelevante
Aspekte betrafen und damit im Regelfall neben der Qualitdt und der Zuverldssigkeit eine der
zentralen Vermarktungsdimension darstellten, inzwischen von ihr zugeliefert wurden. Zwar
prdsentierte KWW diese Ausstattungsmerkmale gegeniiber den Endabnehmern als ihr Verdienst, faktisch war man in diesem Bereich allerdings vollstdndig von dem Zulieferer abhdngigAll dies interessierte Christoph Sacken, den fur die Mittelklassefahrzeuge der KWW zustdndigen Key Account-Manager bei der Kirchhellner AG, momentan wenig. Er war aufdem Weg
zuriick in die Firmenzentrale, nachdem er mit den KWW-Projektverantwortlichen tiber die
neue Version des Mittelklassemodells und die hierfUr durch den entsprechenden Zulieferer
gegebenenfalls zu produzierenden Teile, Komponenten und Module gesprochen hatte. Sacken
war nach einigen Minuten, in denen allgemeine Punkte besprochen worden waren, verstdrkt
auf den Eindruck eingegangen, den er im Rahmen der jUngsten Zusammenarbeit mit KWW
gewonnen hatte und den er insbesondere im Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit der
Unternehmen diskutieren wollte. So hatte er mehrmals daraufhingewiesen, dass sich aus Sicht
der Kirchhellner AG die Geschdftsbeziehung mit der KWW in verschiedener Hinsicht nicht so
entwickelt hatte, wie man dies ansonsten aus der Vergangenheit gewohnt war und auchfUr die
Zukunft eigentlich erwartete. Sacken prdzisierte unter anderem, dass die Bereitschaft der
KWW-Mitarbeiter zum Austausch mit den entsprechenden Mitarbeitern bei der Kirchhellner
AG abgenommen hatte und dass auch die Einhaltung bzw. Anpassung von Vereinbarungen
angesichts sich dndernder Rahmenbedingungen der KWW offensichtlich zunehmend schwerer
falle. Schliefilich sei die Kirchhellner AG auch mit der Verteilung der Risiken nicht immer
einverstanden. Unter anderen hdtten die sich dndernden Rahmenbedingungen dazu beigetragen, dass die Kosten - vor allem bedingt durch die hohen Aufwendungen fUr Forschung und
Entwicklung -fast ausschliefilich aufSeiten des Zulieferers gestiegen seien, wdhrend sich die
KWW geweigert habe, die Verteilung der Ertrdge entsprechend zu modifizieren. Die KWWVerantwortlichen horten sich Sackens Darstellung zwar hoflich an, stellten jedoch im Anschluss daran unmissverstdndlich ihren Standpunkt dar, wonach der steigende Wettbewerbsdruck auch der Kirchhellner AG Konsequenzen abverlange. Die Zeiten seien eben nicht mehr
so wie friiher. Das habe sich auf die nun vergangene letzte Episode der Geschdftsbeziehung
zwar kaum ausgewirkt, miisse aber zukiinftig in einem umso deutlicheren Ausmafi erfolgen.
Sacken war auch kurz vor seiner Ankunft in der Kirchhellner-Firmenzentrale noch verdrgert.
Er hatte die Zahlen recht genau im Kopf und wusste, dass das unkooperative Verhalten der
KWW in derjUngeren Vergangenheit dazu gefiihrt habe, dass im Rahmen vieler Projekte bei
der Kirchhellner AG Verluste aufgetreten waren. Zudem deutete sich nunfiir die Zukunft offensichtlich keine Verbesserung, sondern im Gegenteil eher eine Verschdrfung dieser Situation an. Vor diesem Hintergrund riefer gleich nach seiner Riickkehr seine wichtigsten Mitarbeiter zusammen, um mit ihnen iiber die Situation zu sprechen. Da die KWW fur den Zulieferer ein wichtiger Kunde war, wurde zudem der Vertriebsvorstand der Kirchhellner AG Walter
Schwarz zu dem Gesprdch hinzugezogen. Schnell stellte sich heraus, dass Sackens Eindruck
iiber das Verhalten der KWW von den Ubrigen geteilt wurde. Sdmtliche Mitarbeiter bestdtigten, dass viele Aspekte der Zusammenarbeit im Rahmen der Geschdftsbeziehung nicht mehr so
gut funktionierten, wie dies friiher einmal der Fall gewesen war. Vor allem handelte es sich
dabei um Kritikpunkte, die sich auch okonomisch nachteilig auf die Situation des Zulieferers
ausgewirkt hatten. Hierzu konnte Vertriebsvorstand Schwarz einige Fakten beitragen. Er hatte
in der Vergangenheit bereits mehrmals mit Sacken iiber die steigenden Kosten in diesem Bereich diskutiert. Das Gesprdch verstdrkte nun den Eindruck. Zusdtzlich liefi ihn die Ankiindigung von KWW, fUr die neue Mittelklasse mehrprozentige Preisreduktionen von der Kirchhellner AG zu fordern und sich gleichzeitig nicht mehr mit einem fixen Betrag an den Forschungs- und Entwicklungskosten beteiligen zu wollen, aufhorchen.
Unter diesen Umstdnden miissten alle weiteren Uberlegungen, die auf die zukiinftige Zusammenarbeit mit KWW gerichtet seien, genau iiberpriift werden, betonte Vertriebsvorstand
Schwarz. Hierauf bestand das Vorstandsmitglied, dafiir ihn die Vorteilhaftigkeit einer weiteren Zusammenarbeit mit KWW nicht mehr zweifelsfrei sicher zu sein schien. Neben okonomischen Griinden hatte er auch im Hinblick auf die Stimmung der Mitarbeiter eine starke Unzufriedenheit bemerkt, die er bei den weiteren Schritten nicht vollstdndig auszuklammern gedachte. Schliefilich, so Uberlegte Vorstand Schwarz sich, gab es mehrere Moglichkeiten: Im
Extremfall konnte die Kirchhellner AG eine WeiterfUhrung der Geschdftsbeziehung mit der
KWW unter den angekiindigten neuen Konditionen kategorisch ablehnen. Alternativ wiirden
Verhandlungen iiber die Konditionen moglich sein, die einen Kompromiss zufolge hdtten.
Schliefilich wdre es auch moglich, die geschdftliche Zusammenarbeit so fortzusetzen, wie die
KWW dies wiinschte. Hierfiir wiirde er sich aber, soviet war ihm nach dem Gesprdch mit seinen Mitarbeitern deutlich geworden, nicht ohne weiteres aussprechen. Er warjetzt schon gespannt auf die Reaktion der KWW-Verantwortlichen, die - in dieser Hinsicht war er sich sicher - bestimmt erwartet hatten, dass die Kirchhellner AG die Vorstellungen ihres Nachfragersvollstdndig akzeptieren wiirden.
Die Fallstudie greift einige insbesondere im Hinblick auf Geschaftsbeziehungen wichtige
Aspekte auf. So zahlt seit geraumer Zeit die Kundenzufriedenheit neben der Kundenbindung
zu den im Marketing am ausfuhrlichsten diskutierten Themenfeldem.' Der in nahezu alien
Branchen zunehmende Wettbewerbsdruck, der oftmals auf die Sattigung der Markte und die
steigenden Kosten der Neukundenakquise zuruckzufiihren ist,^ hat diesen Konstrukten nicht
nur in der Wissenschaft, sondem vor allem in der Praxis zu einer hohen Bedeutung
verholfen.^ Kaum thematisiert wurde allerdings bis zum heutigen Zeitpunkt die Frage,
inwiefem die in der Fallstudie skizzierte (Un-)Zufriedenheit des Anbieters (hier des
Automobilzulieferers) Folgen fiir eine Geschaftsbeziehung haben kann."^ Dies ist umso
iiberraschender, wenn die in der Fallstudie geschilderte und fiir viele andere Branchen
typische Situation betrachtet wird. Die dort angedeuteten moglichen Konsequenzen der
Anbieterunzufriedenheit konnen sowohl fiir Anbieter als auch Nachfrager von groBer
okonomischer Bedeutung sein.^ Daher erscheint eine genauere Betrachtung dieses
Themenfeldes notwendig.
Erste Ansatzpunkte hierzu ergeben sich aus den bereits in vielen Facetten untersuchten
Erkenntnissen aus der Zufriedenheitsforschung. So kann in Anlehnung an die dort
vorliegenden Forschungsergebnisse die Vermutung angestellt werden, dass auch Anbieter die
tatsachliche Erfahrung mit dem individuellen Nachfrager im Rahmen des Leistungserstellungsprozesses (Ist) mit einem Vergleichsstandard (Soil), der etwa aus den im Vorfeld
aufgrund von Erfahrungen mit demselben oder auch anderen Kunden vorhandenen
Erwartungen resultieren, vergleichen und etwaige Abweichungen bewerten.^
Hinsichtlich der Bedeutung der Zufriedenheit von Anbietem ist zu erwarten, dass diese vor
allem dann groB ist, wenn zur Leistungserstellung Kooperationen zwischen den Geschaftsbeziehungspartnem erforderlich sind7 Kooperationen zwischen den Geschaftsbeziehungspartnem sind aus zwei zentralen Griinden von stetig steigender Bedeutung. Zum einen fiihrt die in
der Wirtschaft in fast alien Bereichen beobachtbare Konzentration auf Kemkompetenzen
dazu, dass immer hohere Wertschopfungsanteile outgesourct werden.^ Krcal (2005) gibt
Vgl. stellvertretend fiir den deutschen Sprachraum Kunzel (2005), Bruhn/Homburg (2003), Homburg (2003)
sowie die dort angegebenen weiterfiihrenden Literaturhinweise. Vgl. fur den anglo-amerikanischen Raum
insbesondere Fournier/Mick (1999), Oliver (1997) sowie Donovan/Brown/Mowen (2004). Vgl. in Bezug auf
die Automobilindustrie z. B. Ilsarbe (2005), Bauer/Huber/Betz (1998) sowie Dichtl/Peter {\996).
Vgl. Karsten/Sommerlatte (1999), Tietze (2003), S. 68ff. sowie Heise/Hunerberg (1995).
Vgl. z. B. Marschner (2004), S. 140f. sowie Heinzelbecker/Gloggengiefier (2003).
In Ansatzen geht Wong (2000) auf diese Problematik ein.
Rust/ZeithamULemon (2000) stellen hierzu fest: „Not all customers are worth [..] keeping." Vgl. hierzu auch
McCune{\9n).
Vgl. z. B. Kotler/Keller (2006), S. 25f sowie Cadotte/Woodruff/Jenkins (1987).
Vgl. zu Kooperationen und ihren unterschiedlichen Auspragungen z. B. Ringle (2005), S. 47ff. sowie
Steinhorst{lQi(d5),S>AAfl
Vgl. z. B. Pointner (2004), S. 126ff.
beispielsweise die Fertigungstiefe der deutschen Automobilhersteller mit ca. 25 Prozent an.^
Zwischen den Zulieferem, die in der Folge wesentliche Bestandteile des Endproduktes
erstellen und den Herstellem, die zunehmend Koordinationsaufgaben iibemehmen, besteht
daher ein enges Kooperationsverhaltnis.'^ Dabei ist regelmaBig eine Integration des Kunden
(Hersteller) in die Leistungserstellung erforderlich. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn
eine individuelle bzw. individualisierte Leistung erbracht werden soil. Als ursachlich fiir den
Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit des Anbieters und der Kooperation in der
Geschaftsbeziehung kann die Tatsache angesehen werden, dass das AusmaB des Engagements
und die Qualitat der Mitwirkung in entscheidendem MaB die Giite der letztlich durch den
Anbieter erstellten Leistung beeinflussen.'' So wurden im Rahmen einer der zahlreichen
Rtickrufaktionen durch die Automobilhersteller wahrend der letzten Jahre beispielsweise in
den USA klirzlich von Ford vier Millionen Fahrzeuge gleichzeitig zurtickgerufen, da ein
Defekt am Tempomat befurchtet wurde.'^ Am selben Tag rief auch Toyota in den USA eine
Million Fahrzeuge wegen eines moglichen Fehlers an der Lenkung zuriick. Diese Rtickrufaktionen schadeten allerdings nicht nur dem Image der Automobilhersteller, sondem auch dem
der betroffenen Automobilzulieferer. Anbieter mussen daher bei derartigen Leistungserstellungsprozessen priifen, wie die Geschaftsbeziehung hinsichtlich der Mitwirkung des
Nachfragers und anderer Einflussfaktoren, die die Qualitat der Kooperation beeinflussen, zu
beurteilen ist. Nur wenn der Anbieter mit der Mitwirkung des Nachfragers zufrieden ist oder
wenn andere Faktoren eine Unzufriedenheit kompensieren, lohnt sich weiteres Engagement
bei diesen Kunden.'^ Hier zeigt sich, dass ein Schwerpunkt hinsichtlich der Bedeutung der
Anbieterzufriedenheit in der Betrachtung von (potenziell) langerfristigen Geschaftsbeziehungen zu vermuten ist. Dies resultiert aus der Tatsache, dass sich Zufriedenheit immer auf zuvor
vorhandene Erwartungen bezieht, die bei Anbietem in der Regel vor allem auf Erfahrungen
aus bereits vollzogenen Transaktionen basieren.'"^
Auf der anderen Seite kann die Zufriedenheit des Anbieters auch aus Sicht des Kunden von
Bedeutung sein.'^ Immer dann, wenn Kunden spezifisch in den Anbieter investieren, miissen
sie sicherstellen, dass diese Investitionen nicht verloren gehen, well der Anbieter die
Geschaftsbeziehung nicht fortsetzt. Zur Verdeutlichung kann wiederum das Eingangsbeispiel
Vgl./Crca/(2005), S. 503.
Vgl. Wolff (2005), S. 64ff
Die Rolle der PKW-Hersteller entwickelt sich so beispielsweise immer mehr zu der eines „Assemblers" von
durch die ZuHeferer erbrachten Leistungen. Vgl. hierzu auch Wildemann (2004), S. 5.
Vgl. hierzu und im Folgenden o. V. (2005b).
Vgl. Alajoutsijarvi/Moller/Tahtinen (2000).
Vgl. z. B. Stauss (1999).
Fassnacht/Moller (2004), S. 389f stellen beispielsweise fest, dass bedingt durch die starkere Verbindung
der Wertschopfungsketten ein Wechsel von der Konfrontation zur Kooperation mit den Zuliefem (ergo
Anbietern) zu diagnostizieren ist.
5
aus der Automobilindustrie herangezogen werden: Der Automobilzulieferer - in diesem Fall
Anbieter der Leistung - kann die Geschaftsbeziehung bei nicht ausreichender Zufriedenheit
beenden. Auch wenn dies aus Sicht des Automobilherstellers - bedingt durch die im Regelfall
vorliegenden Abhangigkeitsbeziehungen in der Automobilindustrie - bei lediglich geringer
Unzufriedenheit des Zulieferers nicht zu befiirchten ist/^ so ist doch zu konstatieren, dass
schwer wiegende okonomische Griinde dafiir verantwortlich sein konnen, dass der Zulieferer
die „Exit"-Option im Hinblick auf die konkrete Geschaftsbeziehung wahlt.'^ Hierdurch
werden allerdings oftmals umfangreiche spezifische Investitionen des Automobilherstellers
gefahrdet: Dieser hat - hier in der RoUe des Nachfragers - vor allem am Anfang der
Geschaftsbeziehung in der Kegel sowohl zahlreiche spezifische Informationen an den
Anbieter ubergeben (z. B. Informationen iiber das neue Fahrzeugmodell, die erwarteten
Absatzzahlen, uber sonstige Plane etc.) als auch Zeit in die Geschaftsbeziehung (z. B. im
Rahmen gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte) investiert. In der Folge besteht
daher auf Seiten des Nachfragers ein Interesse daran, dass diese Investitionen nicht verloren
gehen. So entsteht etwa durch die Konzentration auf die eigenen Kemkompetenzen bei der
Produktion letztlich fiir den Hersteller das Problem, dass er sich sowohl direkt (z. B. durch
eingeschrankte Kontrollmoglichkeiten des Fertigungsprozesses) als auch indirekt (z. B. durch
den Verlust von Know-how) in Abhangigkeit vom Zulieferer begibt.^^ Dudenhoffer (2003)
beispielsweise betont, dass die Innovationen (im Automobilbereich) durch die Zulieferer
generiert werden.^^ Eine Beendigung der Geschaftsbeziehung durch den OEM (Original
Equipment Manufacturer) als Nachfrager konnte so fiir diesen mit erheblichen Konsequenzen
verbunden sein.^^ Daher sollte auch der Nachfrager im Regelfall ein Interesse an der
Weiterfiihrung der Geschaftsbeziehung mit dem Zulieferer und somit auch an der Ermittlung
der Zufriedenheit des Zulieferers (als Anbieter) haben.
Allerdings wurde die Zufriedenheit von Anbietem bislang keiner genaueren wissenschaftlich
fundierten Untersuchung unterzogen. Daraus folgt, dass zentrale mit dem Konstrukt der
Anbieterzufriedenheit verbundene Fragestellungen bislang noch nicht beantwortet worden
sind. Hierin ist ein wesentliches Forschungsdefizit zu sehen, das mit der vorliegenden Arbeit
in Teilen reduziert werden soil.
Vgl. hierzu Voeth/Gawantka (2005), S. 6ff.
Vgl. z. B. Gunter/Helm (2003), McCune (1998) sowie Gunter/Helm (2003).
Vgl. z. B. Pointner (2004), S. 254f., der auf die Angst vor einem Know-how-Verlust hinweist.
Vgl. Dudenhoffer (2003).
Die Bezeichung Original Equipment Manufacturer (OEM) wird oftmals an Stelle des Begriffs Automobilhersteller verwendet.
2.
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Anknupfend an das aufgezeigte Forschungsdefizit wird in dieser Arbeit folgendes Forschungsziel verfolgt: Es gilt zu klaren, welche Determinanten die Anbieterzufriedenheit
beeinflussen und welche Konsequenzen die Anbieter(un)zufriedenheit hat. Da kaum
Vorarbeiten vorhegen, sind vier aufeinander aufbauende Fragestellungen zu beantworten:
•
Wodurch ist die Zufriedenheit von Anbietem gekennzeichnet, wer empfindet sie und
unter welchen (Rahmen-)Bedingungen ist sie von Relevanz?
•
Wie lasst sich die Zufriedenheit von Anbietem theoretisch fundieren?
•
Welche Determinanten beeinflussen die Zufriedenheit von Anbietem?
•
Hat die (Un-)Zufriedenheit der Anbieter Konsequenzen fiir den langfristigen Erfolg
der Geschaftsbeziehung?
Aufbauend auf diese Fragestellungen soil im Kapitel B zunachst hergeleitet werden, was
unter dem Begriff Anbieterzufriedenheit konkret zu verstehen ist. Hierzu wird einleitend eine
Abgrenzung von anderen Zufriedenheitskonstmkten vorgenommen, urn im Anschluss
zentrale Faktoren zu beschreiben, die als Rahmenbedingungen bestimmen, in welchen
Situationen bzw. Branchen die Zufriedenheit von Anbietem uberhaupt von Relevanz ist.
Dabei soil auch die Frage diskutiert werden, wer die Anbieterzufriedenheit empfmdet
(Individuen versus Gmppen) und wie die Anbieterzufriedenheit entsteht, um Erkenntnisse
uber ihre gmndlegende Stmktur zu erlangen.
Nachdem im ersten Schritt Informationen uber die Anbieterzufriedenheit zusammengetragen
worden sind und der Begriff klarer gefasst wird, soil eine geeignete Theorie zur Fundiemng
dieses Konstmkts abgeleitet werden. Dabei erscheint ein Vergleich der im Marketing
iiblicherweise zur theoretischen Fundiemng herangezogenen Paradigmen - des neoklassischen Ansatzes, des neobehavioristischen Ansatzes und der Neuen Instititutionenokonomik als sinnvoll. Im Anschluss an den Theorienvergleich wird im folgenden Kapitel der
Erklamngsbeitrag der ausgewahlten Theorie flir die Zufriedenheit von Anbietem in
Geschaftsbeziehungen detailliert untersucht. Im Einzelnen erfolgt eine Betrachtung der flir
das Untersuchungsobjekt zentralen Elemente: der Erklamng marktlicher Transaktionsformen
und des Zusammenhangs zwischen der Theorie und der Zufriedenheit von Anbietem. In der
Folge konnen theoriegestlitzt die Determinanten der Anbieterzufriedenheit abgeleitet werden,
um schlieBlich die Spezifikation des Modells, in dem samtliche Hypothesen zu den
Wirkungszusammenhangen enthalten sind, vorzunehmen.
Aufbauend auf die theoretische Fundiemng und die Konzeptuahsiemng des Modells soil im
Kapitel C die Operationalisiemng des Modells vorgenommen werden, um die erforderlichen
Voraussetzungen fur die empirische Untersuchung zu schaffen. Die empirische Untersuchung