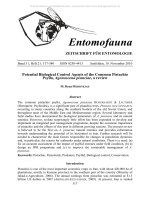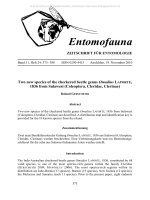Entomofauna, ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE VOL 07-0389-0424
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.53 MB, 36 trang )
Sntomojauna
ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE
Band 7, Heft 30 ISSN 0250-4413
Linz, 30.November 1986
Die westpaläarktischen Arten
der Gattung Gelis Thunberg, 1827,
mit macropteren oder brachypteren Weibchen
(Hymenoptera, Ichneumonidae)
Klaus Horstmann
Zoologisches Institut der Universität Würzburg
Abstract
The Western Palaearctic species of the genus Gelis
THUNBERG,1827, with macropterous or brachypterous females are revised and divided into species groups. A list
of hosts is given, and a key is provided for 34 species.
Seven species are described as new, a new name is given
to Hemiteles simillimus TASCHENBERG var. sulcatus BLUNCK,
1951, (praeocc. in Gelis), two new synonyms are indicated, and lectotypes are designated for five species. In
an appendix, two Eastern Palaearctic species are discussed.
Zusammenfassung
Die westpaläarktischen Arten der Gattung Gelis THUNBERG, 1827, mit macropteren oder brachypteren Weibchen
389
werden revidiert und in Artengruppen aufgeteilt. Eine
Liste von Wirten wird gegeben, und ein Bestimmungsschlüssel für 34 Arten wird aufgestellt. Sieben Arten
werden neu beschrieben, üemiteles simillimus TASCHENBERG
var. sulcatus BLUNCK,1951, (praeocc. in Gelis) wird neu
benannt, zwei neue Synonyme werden angegeben, und für
fünf Arten werden Lectotypen festgelegt. In einem Anhang
werden zwei ostpaläarktische Arten diskutiert.
I. Einleitung
In der Gattung Gelis THUNBERG,l827, gibt es Arten mit
macropteren, brachypteren oder apteren Weibchen oder
Männchen, und der Grad der Flügelreduktion kann bei den
Geschlechtern einer Art unterschiedlich sein. Bei einigen Arten treten macroptere und aptere Männchen nebeneinander auf (AUBERT 1959b: 25 ff«; HORSTMANN 1970:32).
Als einzige Regel scheint zu gelten, daß die Flügel der
Männchen nie stärker reduziert sind als die der zugehörigen Weibchen. Mit der Flügelreduktion ist auch eine
Reduktion der Flügelmuskulatur und eine Umkonstruktion
des Thorax verbunden.
Der Sexualdimorphismus bei vielen Arten beschränkt
sich nicht nur auf die Form und Struktur des Thorax,
sondern betrifft fast alle Körperteile: Form und Färbung
der Antennen, Färbung der Beine, Struktur des Mittelsegments und Struktur und Färbung des Gasters. Dies führt
dazu, daß die Männchen und Weibchen einer Art einander
aufgrund einer nur morphologischen Untersuchung in der
Regel nicht zugeordnet werden können. Da die Weibchen
charakteristischere Merkmale zu besitzen scheinen als
die Männchen und da von vielen Arten nur die Weibchen
beschrieben sind, sind die Männchen in vielen Fällen unbestimmbar. Es ist nicht zu sehen, wie sich dies in absehbarer Zeit ändern kann. Auch die apteren Weibchen
sind zur Zeit meist unbestimmbar, wenn auch aus anderen
Gründen: Die Typen vieler Arten sind zerstört (Coll.FÖRSTER) oder unrevidiert und zur Zeit unzugänglich (Coll.
RUDOW). Da in der Westpaläarktis wahrscheinlich mehrere
hundert Arten existieren, ist ihre Deutung eine Aufgabe,
an die sich bisher niemand gewagt hat.
390
Nur bei den Arten mitraacropterenoder brachypteren
Weibchen ist die Lage anders. Die Artenzahl ist nicht
so groß, die Typen der in der Regel in der Großgattung
Eemiteles GRAVENHORST, 1829, beschriebenen Arten sind
fast vollständig vorhanden und wurden in den letzten
Jahren revidiert, und zwischen den Arten finden sich
brauchbare Unterschiede. Eine Übersicht über diese Arten
soll hier deshalb vorgelegt werden. Solange die Männchen
vieler Arten nicht bekannt sind, kann eine solche Revision freilich nur vorläufige Ergebnisse liefern.
Für die Hilfe bei diesen Untersuchungen dankt der Verfasser Mademoiselle Dr.S.KELNER-PILLAULT (t) (Museum national d'Histoire naturelle, Paris) und den Herren Prof.
Dr.R.ABRAHAM (Zoologisches Museum der Universität Hamburg), Dr.J.-F.AUBERT (Laboratoire d'Evolution des Etres
organises, Paris), M.BAEZ (Departamento de Zoologia y
Ciencias marinas, La Laguna/Tenerife), Dr.C.BESUCHET
' (Museum d'Histoire naturelle, Geneve), Dr.O.BISTRÖM
(Universitetets Zoologiska Museum, Helsingfors), Dr.M.
BONEß
(Leverkusen), E.DILLER (Zoologische Staatssammlung München), Dr.M.G.FITTON (British Museum of Natural
History, London), J.GLOWACKI (Brwinow/Warszawa), Dr.E.
HAESELBARTH (Lehrstuhl für Angewandte Zoologie, München),
Dr.G.HEUSINGER (seinerzeit Lehrstuhl für Tierökologie,
Bayreuth), R.HINZ (Einbeck/Niedersachsen), Dr.A.JAGSCH
(Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft, Scharfling/Oberösterreich), Dr.T.KRONESTEDT (Naturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm), Prof.Dr.G.MORGE (t) (Institut für Pflanzenschutzforschung, Eberswalde, als Kustos der Sammlung
STROBL, Admont), Dr.J.OEHLKE (Institut für Pflanzenschutzforschung, Eberswalde), Dr.R.A.PANTALEONI (istituto di Entomologia, Bologna), Dr.J.PAPP (Termeszettudomänyi Müzeum Allattära, Budapest), Dr.J.SAWONIEWICZ (Instytut Zoologii, Akademia Nauk, Warszawa), M.SCHWARZ
(Ansfelden/Oberösterreich), Dr.M.R.SHAW (Royal Scottish
Museum, Edinburgh), Dr.H.TOWNES (American Entomological
Institute,Gainesville), H.WOLF (Plettenberg) und Drs.K.
W.R.ZWART (Laboratorium voor Entomologie, Wageningen).
391
II. Einteilung in Artengruppen
Die folgende Einteilung soll nicht nur morphologische
Merkmale, sondern auch das WirtsSpektrum der Arten berücksichtigen. Da von vielen Arten keine Wirte bekannt
sind, muß die Einteilung spekulativ bleiben. Auch ist zu
berücksichtigen, daß zumindest einige der genannten Artengruppen wahrscheinlich näher mit Arten mit apteren
Weibchen verwandt sind als mit anderen Arten mit macropteren Weibchen.
1. Gelis areator-Gruppe
Kennzeichnend sind die zwei dunklen Binden der Vorderflügel, von denen die äußere an der Basis der Radialzelle ein deutlich unpigmentiertes Fenster aufweist, der
rot gezeichnete Thorax und die weiß gezeichnete Basis
der Hinterbeine. Die Arten sind polyphage Kokonparasiten
und Hyperparasiten. Hierher gehören: Ichneumon areator
PANZER,1804 (syn. Pezomachus aberrans GRAVENHORST, 1829,
Eemiteles pulchellus GRAVENH0RST,l829, üemiteles orbiculatus GRAVENHORST, 1829, Eemiteles pulchellus minimus
GLOWACKI,1967), Eemiteles pulchellus GRAVENHORST var.
ilicicola SEYRIG,1927, Eemiteles speciosus HELLEN, 1949,
Gelis ilicicolator AUBERT, 1969 (syn. Eemiteles areator
GRAVENHORST ! forma ilicicola AUBERT, 1959, praeocc),
Gelis canariensis sp.n. und Gelis caudator sp.n.
Gelis areator ist wahrscheinlich die am meisten polyphage Art unter den Ichneumonidae der Westpaläarktis
(neben Itoplectis alternans GRAVENHORST,1829). Sie parasitiert an holometabolen Insekten, die als Larven in
frei zugänglichen kleinen oder mittelgroßen Kokons leben
oder sich in diesen verpuppen. Es wurden so viele Wirtsarten bekannt, daß diese hier nicht aufgeführt werden
können; es werden deshalb nur Wirtsgruppen angegeben:
Verpuppungskokons von Chrysopidae, Raupensäcke oder Verpuppungskokons von vielen Microlepidoptera (z. B. Psychidae, Gracillariidae, Glyphipterigidae, Coleophoridae
ob immer als Primärparasit ?), Verpuppungskokons von Eymenoptera-Symphyta (Cimbicidae, Diprionidae, Tenthredinidae) und Verpuppungskokons von vielen Ichneumonidae (z.
B. Campopleginae) und Braconidae (z.B. Microgast erinae),
die ihrerseits an einem weiten Spektrum von Wirten para392
sitieren. Nach den wenigen bekannten Wirten zu urteilen,
ist das Wirtsspektrum von Gelis ilicicolator ähnlich
weit: Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836) (Chrysopidae)
(PANTALEONI)1 und Luffia ferchaultella (STEPHENS, 185O)
(Psychidae) (London).
Gelis areator gehört wie Itoplectis alternans zu einer
kleinen Zahl von extrem polyphagen Ichneumonidae -Arten,
die in zahlreichen publizierten Parasitenlisten auftauchen, aber anscheinend nie als Hauptparasit in Erscheinung treten. Es ist noch unverstanden, wieso diese Arten
so viele verschiedene Wirte finden und parasitieren können, wieso sie aber andererseits bei bestimmten Wirtsarten nicht erfolgreicher sind.
2. Gelis eineta-Gruppe
Die Arten stimmen mit den Arten der Gelis areatorGruppe darin überein, daß der Thorax rot gezeichnet, die
Flügel stellenweise dunkel pigmentiert und die Hintertibien basal weiß gezeichnet sind. Sie unterscheiden
sich dadurch, daß die dunklen Flügelbinden zwar teilweise sehr abgeschwächt sind, die äußere aber nie ein unpigmentiertes Fenster an der Basis der Radialzelle aufweist. Die Arten sind ebenfalls Kokonparasiten und Hyperparasiten, wenn auch anscheinend nicht so ausgeprägt
polyphag. Hierher gehören: Ichneumon cinctus LINNAEUS,
1758 (syn. Hemiteles bicolorinus GRAVENHORST, 1829), Eemiteles longicauda THOMSON, 1884, üemiteles sanguinipectus SCHMIEDEKNECHT, 1932, und Eudelus gallicator AUBERT,
1971.
Von zwei Arten wurden Wirte bekannt: Gelis cincta: Tinea pellionella (LINNAEUS,1758) (Tineidae) (SHAW,London)
und Tineola bisselliella (HUMMEL,1823) (Tineidae) (SHAW);
Gelis longicauda: Psyche casta (PALLAS,1767) {Psychidae)
(ZWART) und Luffia ferchaultella (STEPHENS, 1850) {Psychidae) {ZWART,London). Gelis cincta kommt wie ihre Wirte (Kleidermotten) oft in Wohnungen vor. In der Litera1
In der Regel wird nur vom Verfasser selbst untersuchtes Material
ausgewertet. Bei Privatsammlungen und historischen Sammlungen wird der
Name des Sammlers, bei Museumssammlungen der Name der Stadt in Klammern angegeben.
393
tur wird diese Art auch als Hyperparasit verschiedener
anderer Microlepidoptera genannt, z. B. von Yponomeuta
evonymella (LINNAEUS,1758) (Yponotheutidae) (BAUER 1959:
124), Zeiraphera diniana (GUENEE, 1845) {Tortricidae)
(AUBERT 1966a:3) und Chor istoneuva murinana (HÜBNER,1799)
(Tortricidae) (ZWÖLFER 1956:392).
3. Gelis oimatula-Gruppe
Auch bei diesen Arten ist der Thorax rot gezeichnet
und sind die Flügel stellenweise dunkel pigmentiert. Die
äußere Flügelbinde weist kein unpigmentiertes Fenster
auf, die Binden sind aber insgesamt oft sehr schwach
ausgeprägt. Die Hintertibien sind basal nicht aufgehellt,
sondern im Gegenteil oft schwach verdunkelt. Die Arten
(alle ?) sind Parasiten in Spinnen-Eikokons. Hierher gehören: Hemiteles rubricollis THOMSON,1884, Hemiteles ornatulus THOMSON,1844, Hemiteles fasciitinetus DALLA TORRE,19O2 (syn. Hemiteles fasciipennis BRISCHKE,l88l,praeocc.) und Hemiteles difficilis HEDWIG,1950.
Nur von Gelis fasciitincta wurde ein Wirt bekannt:Eikokons von Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833) (Clubionidae) (SHAW, ZWART, London).
4. Gelis rugifer-Gruppe
Im Gegesatz zu den bisher genannten Arten ist bei den
Arten dieser Gruppe der Thorax ganz dunkel, ebenso sind
die Mandibeln und die Tegulae dunkel. Die Vorderflügel
sind nur schwach dunkel gezeichnet. Kennzeichnend ist
der kurze Bohrer (Bohrerklappen deutlich kürzer als das
1. Gastersegment). Die Arten sind Parasiten in SpinnenEikokons. Hierher gehören: Hemiteles rugifer THOMSON,
1884, Hemiteles brevicauda THOMSON, 1884, Hemiteles balteatus THOMSON,1885 (syn. Charitopes brevistylus HELLEN,
1967) und Hemiteles thomsoni SCHMIEDEKNECHT, 1933 (syn.
Hemiteles dispar THOMSON, 1885, praeocc).
Bei den durchgeführten Untersuchungen wurde nur für
eine Art ein Wirt bekannt: Gelis rugifer: Eikokon von
Clubiona reclusa CAMBRIDGE, 1863, (Clubionidae) (SHAW).
NIELSEN (1932:674) gibt Wirte von zwei weiteren Arten
an: Gelis balteata: Clubiona gracilis HENTZ, 1847; Gelis
thomsoni (syn. Hemiteles dispar): Clubiona sp. (beides
394
Clubionidae).
5. Gelis yieina-Gruppe
Bei der einzigen Art dieser Gruppe sind die Stirn und
das Mesoscutum auffällig gerunzelt und punktiert, stellenweise quergerunzelt. Der Thorax ist schwarz, die Flügel sind nicht dunkel gezeichnet, die Hintertibien sind
basal nicht aufgehellt. Die Art parasitiert gregär an
den Puppen von Lepidoptera -Rhopalocera (AUBERT 1954,
BLUNCK und JANßEN 1957). Hierher gehört nur Hemiteles
vicinus GRAVENHORST,l829 (syn. Hemiteles melanavius GRAVENHORST, 1829).
Für diese Art wurden folgende Wirte bekannt: Pieris
brassicae (LINNAEUS, 1758) (Pieridae) (HINZ), Pieris rapae (LINNAEUS,1758) (Pieridae) (London), Vanessa atalanta (LINNAEUS,1758) {Nymphalidae) (HINZ,SHAW) und Inachis
io (LINNAEUS,1758) {Nymphalidae) (München).
6. Gelis alopecosae-Gruppe
Bei der einzigen Art dieser Gruppe ist der Wangenraum
mehr als 1,5 mal so breit wie die Mandibelbasis,das Mittelsegment in den Feldern grob gerunzelt, das l.Gastersegment nur so lang wie breit und deutlich längsgerunzelt und der Bohrer ohne deutlichen Nodus und ohne Zähne.
Der Thorax ist schwarz, die Flügel sind nicht dunkel gezeichnet, die Hintertibien sind basal nicht aufgehellt.
Die Art parasitiert gregär in Spinnen-Eikokons• Hierher
gehört nur Gelis alopecosae sp.n.
Als Wirt für diese Art wurde bekannt: Eikokons von
Alopecosa aculeata (CLERCK,1757) (Lycosidae) (KRONESTEDT).
7. Gelis glaeialis-Gruppe
Bei den Arten dieser Gruppe ist der Kopf auffällig
glänzend, und Stirn, Scheitel und Schläfen sind zumindest stellenweise glatt. Der übrige Körper ist fein gekörnelt, der Thorax ist schwarz, die Flügel sind nicht
dunkel gezeichnet, und die Hintertibien sind basal nicht
aufgehellt. Wirte sind nicht bekannt. Vielleicht fällt
diese Artengruppe mit der folgenden zusammen. Hierher
gehören Hemiteles glaeialis H0LMGREN,l869 (syn.Hemiteles
aeneus THOMSON,1884) und Gelis nitida sp.n.
395
8. Gelis aZ-fcipalpus-Gruppe
Die Arten dieser Gruppe sind durch das Fehlen besonderer Merkmale gekennzeichnet. Der Körper ist überwiegend
gekörnelt und nicht stellenweise auffällig glatt oder
gerunzelt, das 1. Gastersegment ist länger als breit,die
Bohrerklappen sind mindestens so lang wie das 1. Gastersegment, die Bohrerspitze besitzt einen Nodus und Zähne,
und der Thorax ist schwarz. Die Vorderflügel sind klar
oder unterschiedlich stark dunkel gezeichnet, die Hintertibien sind basal zuweilen aufgehellt, zuweilen aber
auch nicht. Bei den Arten mit bekannten Wirten handelt
es sich um Kokonparasiten und Hyperparasiten, aber die
Wirte der meisten Arten sind unbekannt. Bei besserer
Kenntnis der Lebensweise wird sich diese Gruppe vielleicht besser charakterisieren und von anderen Artengruppen abgrenzen lassen2. Hierher gehören: Hemiteles
gibbifrons THOMSON, 1884, Hemiteles elymi THOMSON, 1884,
Hemiteles albipalpus THOMSON, 1884, Hemiteles melanogaster THOMSON,1884, Hemiteles infumatus THOMSON,1884, Hemiteles meuseli LANGE, 1911, Hemiteles zeirapherator AUBERT,1966, Charitopes breviceps HELLEN,1967, Gelis brassicae nom.n. (syn. Hemiteles simillimus TASCHENBERG var.
sulcatus BLUNCK, 1951, praeocc), Gelis falcata sp.n.,
Gelis fumipennis sp.n. und Gelis obscuripes sp.n.
Von drei Arten wurden Wirte bekannt: Gelis albipalpus:
Coleophora laricella (HÜBNER, 1817) (Coleophoridae)
(JAGSCH), Agonopteryx ulicetella (STAINTON, 1849) (Oecophovidae) (London), unbekannter Primärparasit aus Yponomeuta evonymella (LINNAEUS,1758) und Y. padella (LINNAEUS,1758) (Yponomeutidae) (HAESELBARTH, HEUSINGER), Apanteles sp. (Braconidae) aus Choristoneura murinana (HÜBNER, 1799) (Tortrieidae) (HEASELBARTH) und Microgaster sp.
{Braconidae) aus Erannis defoliaria (CLERCK, 1759) (Geometridae) (HINZ); Gelis zeirapherator: Phytodietus sp.
2
So könnten die Arten Gelis caudator sp.n. und Gelis falcata sp.n.
(Merkmale: rücklaufender Nerv mit nur einem Fenster; Gaster von der
Seite zusammengedrückt; Bohrer lang, dünn und abwärts gebogen) beziehungsweise Gelis fumipennis sp.n. und Gelis obscuripes sp.n. (Merkmale: Bohrer relativ kurz, Spitze kurz und hoch) auch in eigene Artengruppen gestellt werden.
396
(Ichneumonidae) aus Zeirapheva diniana (GUENEE, 1845)
(Tortricidae) (AUBERT, HINZ) und unbekannter Primärparasit aus Setina aurita ramosa (FABRICIUS, 1793) (Arctiidae) (HORSTMANN); Gelis brassicae: Diplodoma herminata
(GEOFFROY,1785) (Psychidae) (SHAW), unbekannter Primärparasit aus Yponomeuta evonymella (LINNAEUS, 1758) {Yponomeutidae) (HINZ), Dicudegma sp. {ichneumonidae) aus
Flutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Yponomeutidae)
(HORSTMANN), Apanteles solitarius (RATZEBURG,1844) (Braconidae) aus Leucoma salicis (LINNAEUS,1758) (Lymantriidae) (SHAW), unbekannter Primärparasit aus Thyria jacobaeae (LINNAEUS,1758) (Arctiidae) (London) und Apanteles
glomeratus (LINNAEUS,1758) {Bvaconidae) aus Vieris brassicae (LINNAEUS,1758) und P. rapae (LINNAEUS,1758) (Pieridae) (HORSTMANN, SAWONIEWICZ, TOWNES, Genf, London).
III. Tabelle der Weibchen
1
Vorderflügel mit zwei deutlichen Binden, die äußere
an der Basis der Radialzelle ein unpigmentiertes
Fenster freilassend (oder die äußere Binde mehr oder
weniger in zwei Binden aufgelöst, die Basalhälfte der
Radialzelle freilassend); Flügel immer normal ausgebildet
2
äußere Flügelbinde ohne unpigmentiertes Fenster an
der Basis der Radialzelle oder Flügelbinden insgesamt
abgeschwächt oder fehlend oder Flügel stark verkürzt
7
2 Flügelbinden nicht sehr deutlich, die äußere mehr
oder weniger in zwei Binden aufgelöst, die die Basalhälfte der Radialzelle freilassen;Bohrerklappen knapp
zweimal so lang wie die Tibien III; Bohrer am Ende
abwärts gebogen
caudator sp.n.
- Flügelbinden deutlich, die äußere an der Basis der
Radialzelle nur ein kleines Fenster freilassend; Bohrer kürzer, gerade
3
3 Bohrerklappen etwas länger als die Tibien III; Pronotum lateral, Mesopleuren und Metapleuren im Zentrum
spiegelglatt; Kopf und Thorax rot gezeichnet; Gaster
dunkel
canariensis sp.n.
- Bohrerklappen etwas kürzer als die Tibien III; Pronotum lateral, Mesopleuren und Metapleuren im Zentrum
397
oft mit feinem Chagrin, glänzend; Gaster an der Basis
oft rot gezeichnet
4
4 Area superomedia länger als breit, innen weitgehend
glatt; Kopf und Thorax fast ganz rot
speciosa (HELLEN,1949)
- Area superomedia so lang wie breit oder quer, innen
gekörnelt oder gerunzelt; oft Kopf und Thorax dunkel
gezeichnet
5
5 Wangenraum 1,1 - 1,2 mal so breit wie die Mandibelbasis; Kopf und Thorax fast ganz rot; Gaster ganz
dunkel
ilicicola (SEYRIG,1927)
- Wangenraum 0,9 mal so breit wie die Mandibelbasis;oft
Kopf und Thorax dunkel gezeichnet und/oder Gaster
hell gezeichnet
6
6 Kopf und Thorax in der Regel ganz oder fast ganz rot
und gleichzeitig Gaster dunkel, nur die Ränder der
vorderen Tergite rot gezeichnet (wenn Kopf und/oder
Thorax deutlich dunkel gezeichnet, dann Gaster ganz
dunkel)
ilicicolator AUBERT, 1969
Kopf und Thorax in der Regel rot und schwarz gezeichnet und gleichzeitig Gaster auf den vorderen Tergiten
deutlich rot gezeichnet (wenn Kopf und Thorax fast
ganz rot, dann auch 2. Gastertergit fast ganz rot)...
areator (PANZER,1804)
7 Thorax deutlich rot gezeichnet
8
- Thorax schwarz, höchstens Pronotum frontal rotbraun
gerandet
15
8 Bohrerklappen deutlich länger als die Tibien III... 9
Bohrerklappen deutlich kürzer als die Tibien III.. 11
9 Prothorax und angrenzende Nähte des Mesothorax rot,
sonst Thorax dunkel; Tibien III braun, basal weißlich
gezeichnet; Fühler fadenförmig, vorletzte Glieder
knapp so lang wie breit; Bohrer abwärts gebogen
longicauda (THOMSON,1884)
Pro- und Mesothorax rot; Tibien III rot, basal nicht
aufgehellt, apical verdunkelt; sonst unterschiedlich.
10
10 Fühler deutlich etwas keulenförmig;
3- Fühlerglied
länger als das 4-, vorletzte Glieder länger als
breit;
Postpetiolus kürzer als der Petiolus; Boh-
398
rer
11
12
13
14
-
15
16
17
gerade; Tegulae gelb
fasciitincta (.DALLA TORRE, 1902)
Fühler etwa fadenförmig; 3- Fühlerglied kürzer als
das 4-j vorletzte Glieder breiter als lang; Postpetiolus länger als der Petiolus; Bohrer abwärts gebogen; Tegulae braun
rubricollis (THOMSON,1884)
Flügel sehr stark verkürzt, Vorderflügel wenig länger als die Tegulae; Kopf schwarz; Tibien III basal
weder aufgehellt noch dunkel gezeichnet; 1. Gastersegment dunkelbraun, nur Enddrittel des Postpetiolus
rot
difficilis (HEDWIG,1950)
Flügel voll ausgebildet; sonst unterschiedlich... 12
Kopf rot oder rot gezeichnet; Vorderflügel nur mit
einer Binde (im Bereich des Pterostigmas) oder fast
nicht dunkel gezeichnet
13
Kopf schwarz; Vorderflügel mit zwei deutlichen Binden
14
Area superomedia länger als breit; Kopf und Thorax
auch dorsal rot
gallicator (AUBERT,197l)
Area superomedia knapp so lang wie breit; Kopf und
Thorax dorsal schwarz
sanguinipectus (SCHMIEDEKNECHT,1932)
Mandibeln basal hellrot; Tibien III braun, basal mit
hellem Ring (nicht immer deutlich); Gaster ganz oder
fast ganz dunkel
cincta (LINNAEUS,1758)
Mandibeln dunkel; Tibien III rotbraun, basal schmal
verdunkelt; Gaster basal rotbraun (meist das 1.-3Tergit)
ornatula (THOMSON, 1884)
Bohrerklappen deutlich kürzer als das 1. Gastersegment; Mandibeln und Tegulae dunkel
16
Bohrerklappen mindestens so lang wie das 1. Gastersegment; sonst unterschiedlich (Gelis obscuripes ist
über beide Alternativen zu erreichen)
20
Scheitel, Schläfen und Seitenlappen des Mesoscutums
mit glattem Grund; Mesopleuren stellenweise fein
längsgestreift auf glattem Grund
brevicauda (THOMSON,1884)
Scheitel, Schläfen, Mesoscutum und Mesopleuren mehr
oder weniger deutlich gekörnelt; Mesopleuren zuweilen zusätzlich gerunzelt
17
Flügel stark verkürzt, Vorderflügel nicht wesentlich
399
18
19
20
21
-
22
länger als die Tegulae; Mittelsegment an der Basis
ungefeldert; Postpetiolus gekörnelt, nicht gerunzelt
oder gestreift; Coxen rot; Femora III apical, Tibien
III basal und apical und Tarsen III verdunkelt; 2.3- Gastertergit rot., thomsoni (SCHMIEDEKNECHT,1933)
Flügel normal ausgebildet; Mittelsegment normal gefeldert; Postpetiolus oft neben der Körnelung gerunzelt; sonst unterschiedlich
18
Femora III 3,8 - 4 mal so lang wie hoch; 1. und 2.
Gastertergit nur gekörnelt; Bohrerklappen mehr als
halb so lang wie das 1. Gastersegment
28
Femora III 4,7 - 5,3 mal so lang wie hoch; zumindest
Postpetiolus deutlich gerunzelt oder längsgestreift;
Bohrerklappen oft kürzer
19
Coxen und das 2.-3. Gastertergit ganz rot
balteata (THOMSON,1885)
Coxen und Gaster überwiegend oder ganz dunkel
rugifer (THOMSON,1884)
Stirn, Scheitel und Schläfen mit glattem Grund; Coxen und Gaster schwarz
21
Stirn, Scheitel und Schläfen mehr oder weniger gekörnelt oder gerunzelt; in Zweifelsfällen Coxen und/
oder Gaster median hell
22
die drei basalen Geißelglieder zusammen 5-7 mal so
lang wie breit, das 3- Geißelglied (5< Fühlerglied)
1,7 - 2,0 mal so lang wie breit; Mesopleuren median
glatt, dorsal und ventral fein längsgestreift oder
mit Längskörnelreihen; Femora III 3,6 - 3,7 mal so
lang wie hoch
glacialis (HOLMGREN,l869)
die drei basalen Geißelglieder zusammen 7 - 9 mal so
lang wie breit, das 3« Geißelglied 2,2 - 2,7 mal so
lang wie breit; Mesopleuren median glatt, frontal,
dorsal und ventral fein punktiert; Femora III 3,8 4,1 mal so lang wie hoch
nitida sp.n.
Mittelsegment unvollständig gefeldert, nur die hintere Querleiste deutlich, der dorsale Teil lang,sehr
undeutlich gefeldert, Area basalis und superomedia
vereinigt, zusammen etwa viermal so lang wie breit;
Vorderflügel mit zwei hellbraunen Binden; Tibien III
braun, basal deutlich weiß gezeichnet
meuseli (LANGE,1911)
400
23
24
25
26
27
28
29
Mittelsegment mehr oder weniger vollständig gefeldert, Area basalis und superomedia deutlich getrennt,
zusammen höchstens zweimal so lang wie breit; oft
auch sonst abweichend
23
Coxen schwarz; zwei oder drei mittlere Gastertergite
ganz rot
24
Coxen hell, zumindest die Coxen I und II, und/oder
Gaster fast ganz oder ganz dunkel
26
Stirn und Mesoscutum deutlich punktiert und gerunzelt, stellenweise quergerunzelt; Flügel klar
vieina (GRAVENHORST,l829)
Stirn und Mesoscutum gekörnelt, teilweise zusätzlich
fein punktiert, nicht gerunzelt; Vorderflügel im Bereich der Areola wolkig getrübt
25
die vier basalen Geißelglieder rot gezeichnet; Bohrerklappen kürzer als die Tibien III; diese rot, basal nicht weiß gezeichnet... infumata (THOMSON,1884)
Geißelbasis nicht breit rot gezeichnet; Bohrerklappen länger als die Tibien III; diese basal weiß gezeichnet
breviceps (HELLEN,1967)
Vorderflügel mit zwei braunen Binden, die innere zuweilen undeutlich, die äußere breit und deutlich. 27
Vorderflügel klar oder nur undeutlich getrübt.... 29
Costulae weit hinter der Mitte der Area superomedia
ansetzend; Bohrerklappen deutlich länger als das 1.
Gastersegment; Bohrerspitze (vom Nodus an gerechnet)
etwa dreimal so lang wie hoch
gibbifrons (THOMSON,1884)
Costulae etwa in der Mitte der Area superomedia ansetzend (Abb. 18 und 19); Bohrerklappen so lang wie
das 1. Gastersegment; Bohrerspitze knapp zweimal so
lang wie hoch (Abb. 25 und 26)
28
Felder des Mittelsegments (mit Ausnahme der vorderen
Seitenfelder) gerunzelt; Fühlerbasis bis etwa zum 5Glied, Beine und 2.-4-Gastertergit rot
fumipennis sp.n.
Felder des Mittelsegments nur gekörnelt; Fühlerbasis
überwiegend dunkel; Beine und Mitte des Gasters in
der Regel dunkel gezeichnet
obscuripes sp.n.
Gaster am Ende von der Seite zusammengedrückt;Bohrer
abwärts gebogen
falcata sp.n.
401
30
31
32
33
34
-
Gaster am Ende nicht von der Seite zusammengedrückt;
Bohrer gerade
30
Bohrerklappen deutlich länger als die Tibien III;
Coxen dunkel; Gaster dunkel, nur die Segmentränder
zuweilen hell gezeichnet
31
Bohrerklappen höchstens so lang wie die Tibien III;
zuweilen einige oder alle Coxen hell und/oder Mitte
des Gasters breiter rot gezeichnet
32
Area superomedia länger als breit; Palpen, Mandibeln,
Fühler und Tegulae dunkelbraun bis schwarz
zeivapherator (AUBERT,1966)
Area superomedia breiter als lang; Palpen, Mitte der
Mandibeln, Geißelbasis bis etwa zum 10.Glied und Tegulae gelbbraun
elymi (THOMSON, 1884)
Wangenraum mehr als 1,5 mal so breit wie die Mandibelbasis; Mittelsegment in den Feldern überwiegend
grob gerunzelt (Abb.21); 1.Gastersegment so lang wie
breit; Bohrerspitze ohne deutlichen Nodus und ohne
Zähne (Abb.28)
alopecosae sp.n.
Wangenraum schmaler; Mittelsegment nicht so grob gerunzelt; 1.Gastersegment schlanker; Bohrerspitze mit
deutlichem Nodus und mit Zähnen
33
Bohrerklappen wenig länger als das 1 .Gastersegment;
Palpen auffällig weiß; Gaster ganz schwarz
albipalpus (THOMSON,1884)
Bohrerklappen mindestens 1,5 mal so lang wie das 1.
Gastersegment; Palpen gelblich oder bräunlich; zuweilen Mitte des Gasters rot gezeichnet
34
Stirn und Mesoscutum durchaus matt gekörnelt; Bohrerklappen etwas kürzer als die Tibien III; Gaster
schwarz, Segmentränder schmal hell; Coxen III basal
schwarz
melanogaster (THOMSON, 1884)
Stirn und Mesoscutum glänzend, oft stellenweise
glatt; Bohrerklappen knapp so lang wie die Tibien
III; oft alle Coxen rot; oft Gaster median rot oder
rot gezeichnet
brassicae nom.n.
IV. Diskussion einiger schon beschriebener Arten
Folgende Arten wurden in neueren Publikationen revidiert, weshalb Zitate, Typennachweise und Synonyme hier
nicht noch einmal angeführt werden müssen: Ichneumon
402
cinctus LINNAEUS (FITTON 1978: 364), Ichneumon areator
PANZER (HORSTMANN 1982: 236), die Arten GRAVENHORSTs
(HORSTMANN 1979a),THOMSONs (HORSTMANN 1979b; 1984; FITTON 1982) und SCHMIEDEKNECHTs (HORSTMANN 1983) sowie Hemiteles difficilis HEDWIG (HORSTMANN 1981: 71). Weitere
Bemerkungen werden hier zusammengestellt.
Hemiteles glacialis HOLMGREN.1869
Hemiteles glacialis HOLMGREN, 1869:20 - Lectotypus (9)
hiermit festgelegt: "Advent Bay.", "HOLMGREN" (Stockholm). HELLEN (1967:100) hat für die Art die Gattung
Arctodeuon HELLEN,1967, errichtet, und TOWNES (1970: 54)
hat diese mit Gelis THUNBERG synonymisiert (Arctodoeon !
in TOWNES 1970:54 und 520 wird als inkorrekte sekundäre
Schreibweise betrachtet).
Hemiteles fasciipennis BRISCHKE,l88l
Hemiteles fasciipennis BRISCHKE, l88l: 348- praeocc.
durch Hemiteles fasciipennis BRÜLLE,1846 -Lectotypus (9)
hiermit festgelegt: "fasciipennis 9. Preussen ... Br."
(teilweise unleserlich) (STROBL). Da BRISCHKE (I.e.) eine Zucht aus Spinnennestern und aus Microgaster-Kokons
erwähnt, hatte er wahrscheinlich gemischtes Material vor
sich. Die Exemplare aus Microgaster-Kokons gehörten möglicherweise zu Gelis longicauda (THOMSON) (vgl.SCHMIEDEKNECHT 1897:512; PFANKUCH 1913:331). Von einer zweiten
Art, die häufig aus Eikokons von Agroeca-Arten (Clubionidae) gezogen wird, befinden sich zwei Syntypen (l 9,
1 6) in der Sammlung STROBL (vgl.STROBL 19O1:23O)3. DALLA TORRE (1902:649) hat die praeoecupierte Art BRISCHKEs
mit dem Namen Hemiteles faseiitinetus neu benannt.
Hemiteles dispar THOMSON,1885
Da die Art durch Hemiteles dispar RATZEBURG,1844,praeoecupiert ist, wurde sie von SCHMIEDEKNECHT (1933:88 f.)
als Hemiteles thomsoni neu benannt. Die Typen sind ver3
Wie STROBL (1901:132) selbst erwähnt, hat er von BRISCHKE eine Vergleichssammlung erworben, in der auch Typen enthalten sind. Dies ist
deshalb von Bedeutung, weil die Sammlung BRISCHKEs im letzten Krieg
vollständig zerstört worden ist.
403
schollen (AÜBERT 1968:196), und die Art war bisher ungedeutet. Im Britischen Museum (London) befinden sich unter dem Namen Gelis dispar (THOMSON) 2 99 aus Ringsjö/
Südschweden, die gut mit der Beschreibung THOMSONs übereinstimmen. Die Deutung der Art wird deshalb hier entsprechend festgelegt.
Die Art ist Gelis balteata (THOMSON) sehr ähnlich und
weicht nur durch folgende Merkmale ab (99): Flügel ganz
stark verkürzt, Vorderflügel nicht wesentlich länger als
die Tegulae; Thorax etwas schmaler; Notauli verloschen;
Mittelsegment an der Basis ungefeldert; Femora III 4,0 4,2 mal so lang wie hoch (balteata: 4,7-4,9 mal); Postpetiolus gekörnelt,nicht gerunzelt (balteata: Postpetiolus neben der Körnelung längsgerunzelt); Femora III apical, Tibien III basal und apical und Tarsen III verdunkelt.
Eemiteles meuseli LANGE,1911
Hemiteles Meuseli LANGE,1911:542 - Lectotypus (9) hiermit festgelegt: "Crni Padez", 1423 m., Croatia, MEUSEL,
22.9.10." (Coll. LANGE, zur Zeit Eberswalde). Die von
LANGE (I.e.) mit Bedenken zur gleichen Art gestellten
Männchen gehören in der Tat hierher.
Eemiteles pulchellus GRAVENHORST var. ilicicola SEYRIG,
1927
Hemiteles pulchellus GRAVENHORST var. ilicicola SEYRIG,
1927:215 - Lectotypus (9) hiermit festgelegt: "Espiel,
Sierra-Morena, 28-2-26, SEYRIG" (Paris). AUBERT (1966b:
170) hat diese Form zu Recht in den Rang einer Art erhoben.
Eemiteles speciosus HELLEN,1949
Hemiteles speciosus HELLEN,1949:8 - weibliche Syntypen
seit langer Zeit ausgeliehen und unzugänglich, Deutung
nach 1 6 aus Helsinki (Syntypus) und nach 1 9 und 1 6
aus La Laguna (vgl. ORTEGA und BAEZ 1980:82 ff.).
Eemiteles difficilis HEDWIG,1950
Die Art ist Gelis ornatula (THOMSON) sehr ähnlich und
weicht von dieser durch folgende Merkmale ab (99): Füh404
ler median etwas gedrungener, 7-Fühlerglied 1,5 mal so
lang wie breit (ornatula: 1,8 - 2,0 mal); Clypeus basal
sehr fein gekörnelt, nicht deutlich punktiert; Flügel
ganz stark verkürzt, Vorderflügel nicht wesentlich länger als die Tegulae; Area superomedia und petiolaris gekörnelt, nicht gerunzelt, matt; Tibien III basal nicht
deutlich verdunkelt; 1.Gastersegment dunkelbraun, nur
Enddrittel des Postpetiolus rot.
Hemiteles simillimus TASCHENBERG var. sulcatus BLUNCK, •
1951
Hemiteles simillimus TASCHENBERG var. sulcatus BLUNCK,
1951:346 ff. - praeocc. in Gelis durch Gelis sulcata CEBALLOS,1925 - Lectotypus (9) hiermit festgelegt: "Allemagne, Bonn a. Rh., 1946, Dr. H. BLUNCK", "Ex Apanteles
glomeratus s. Vieris", "46/3• lehn. 3/14","Hemiteles simillimus TASCHB. var. ou sp. nov., Ch. FERRIERE det. 96"
(Genf). BLUNCK (I.e.) gibt in seiner Beschreibung an,daß
sich die Typen in seiner eigenen Sammlung und in den Museen in Bonn und Genf befinden sollen. Die Sammlung
BLUNCK konnte ich nicht ausfindig machen, und im Alexander-Koenig-Museum in Bonn war kein Material zu finden.
Dagegen befinden sich sichere Syntypen in der Sammlung
FERRIERE in Genf (3 99, 7 66), andere in der Sammlung
TOWNES (1 9) und in London (3 99).
SAWONIEWICZ (1984:314) hat dieses Taxon korrekt gedeutet und in den Rang einer Art erhoben. Die Art ist in
Mitteleuropa häufig; sie war bisher unter dem Namen "Hemiteles floricolator GRAVENHORST" sensu THOMSON (1884:
981) et auet. (nee Ichneumon floricolator GRAVENHORST,
1807) bekannt. Sie wird hier neu benannt: Gelis brassicae nom.n.
Charitopes breviceps HELLEN,1967
Chritopes breviceps HELLEN, 1967: 97 ff. - Holotypus
(9): "Ik Ollila, 16/6 1932, K. Lahtivirta, Fennia" (Helsinki) .
Charitopes brevistylus HELLEN,1967
Charitopes brevistylus HELLEN,1967=98 - Holotypus (9):
"Rantasalmi", "HELLEN", "620" (Helsinki).Die Art ist ein
405
Synonym von Gelis balteata (THOMSON)
298).
(HORSTMSNN
1979b:
Hemiteles pulchellus GRAVENHORST subsp. minimus GLOWACKI,
1967
Hemiteles pulchellus GRAVENHORST subsp. minimus GLOWACKI, 1967:100 - Holotypus (9): "Puszczykowo, XII. 1961,
leg.J.J.KARPINSKI" (GLOWACKI). Die Art ist ein Synonym
von Gelis areator (PANZER) (syn.n.).
Gelis ilicicolator AUBERT,1969
Die Geschichte der Benennungen dieser Art ist verwickelt.
Zuerst hat AUBERT (1959a:149) ein Taxon "Hemiteles areator GRAVENHORST forma ilicicola" beschrieben und als verschieden von Hemiteles pulchellus GRAVENHORST var. ilicicola SEYRIG (vgl. oben) betrachtet. Der Name ist verfügbar (Artikel 455 e der Nomenklaturregeln), er ist allerdings ein primäres Homonym der Form SEYRIGs. AUBERT
hat dieses Taxon später nicht wieder erwähnt, aber bei
einem Vergleich der Fundorte kann man vermuten, daß er
es stillschweigend zu Gelis ilicicolator gestellt hat
(vgl. AUBERT 1966b:170). Es wird hiermit mit dieser Art
synonymisiert (syn.n.).
Später hat AUBERT (1966b:170) zu Recht darauf hingewiesen, daß Hemiteles pulchellus GRAVENHORST var. ilicicola SEYRIG eine eigene Art darstelle, hat aber zu Unrecht angenommen, daß dieser Name nicht verfügbar sei.
Der von ihm für diese Art aufgestellte Name Gelis ilicicolator ist deshalb primär als Synonym veröffentlicht,
ist nicht verfügbar und tritt nicht in die Homonomie ein
(Artikel 11, d und 54, 1 der Nomenklaturregeln).
In einer dritten Arbeit schließlich vermutet AUBERT
(1969:45), daß eine Art "Gelis ilicicolator" sowohl von
Gelis areator (PANZER) als auch von Gelis ilicicola (SEYRIG) verschieden sei, gibt ein Unterscheidungsmerkmal an
und verweist auf seine frühere Publikation (AUBERT,1966b:
170), in der andere Merkmale genannt werden. Obwohl sich
AUBERT nur unbestimmt darüber ausdrückt, ob er die drei
Taxa tatsächlich als drei verschiedene Arten anerkannt
haben will ("Cette repartition curieuse permet de supposer qu'ill pourrait s'agir de trois especes distinc406
tes."), wird dieser Text als ausreichend zur Aufstellung
des Namens anerkannt. Dieser muß dann allerdings von
1969 datiert werden.
Während sich die Weibchen von Gelis areatov und G.ilicicolator im wesentlichen nur durch das Farbmuster unterscheiden lassen (vgl. oben), wobei die Variabilität
bei beiden Arten erheblich ist, findet sich bei den
Männchen auch ein morphologisches Unterscheidungsmerkmal: bei G. areatov ist der größte Durchmesser eines
hinteren Ocellus 2,0 - 2,5 mal so lang wie der Abstand
zwischen einem hinteren Ocellus und dem Facettenauge,bei
G. ilicicolator ist er 3,3 - 4,0 mal so lang.
Die Art kommt nicht nur in Frankreich vor (AUBERT),
sondern auch in Südengland (London), Norditalien (PANTALEONI) und Israel (London).
V. Neubeschreibungen
Gelis caudator sp.n.
Holotypus (9): "00., Zwettl, Langzwettl, 1.6.84, M.
SCHWARZ" (bei Linz/Öberösterreich) (HORSTMANN).
Paratypen: 3 99 vom gleichen Fundort, Fangdaten 28.10.
83 und 24.ll.80 (1 9 HORSTMANN, 2 99 SCHWARZ); 1 9 aus
Hellbrunn/Salzburg, 10.4-84 (SCHWARZ); 1 9 aus Deutschland, Coll.RUTHE (ohne nähere Angaben) (London); 1 9 aus
Lomma/Warszawa, 24.4-76, 1 9 aus Dziekanow Lesny/Warszawa, 7.4.74 (beide SAWONIEWICZ).
9: Schläfen kurz und deutlich verengt (Abb.l); Gesicht
etwas breiter als die Stirn; Fühler 25-gliedrig, schlank
(Abb.8), fadenförmig, vorletzte Glieder wenig länger als
breit; Wangenraum knapp so breit wie die Mandibelbasis;
Clypeus vom Gesicht nur undeutlich getrennt, im Profil
stark gerundet, mit glattem Grund, basal deutlich punktiert, Endrand schmal lamellenförmig, gerade; Kopf gekörnelt, matt, im Bereich der Wangen glänzend; Thorax
gekörnelt und sehr fein punktiert; Pronotum lateral, Mesopleuren und Metapleuren mit Längskörnelreihen und feinen Längsstreifen; Scutellargrube nicht deutlich gestreift; Speculum glatt; Areola sehr fein geschlossen;
rücklaufender Nerv mit nur einem Fenster; Nervellus bei
l/3 seiner Länge sehr deutlich gebrochen; Beine mäßig
407
schlank, Femora III 4,2 mal so lang wie hoch; Mittelsegment rundlich, fein gefeldert; Dorsolateralleisten weitgehend verloschen; dorsale Felder gekörnelt, matt; Area
superomedia etwas länger als breit (Abb.15); Area petiolaris lateral vollständig gerandet, sehr wenig eingesenkt, fein gekörnelt und deutlich glänzend; 1. Gastersegment relativ schlank, dorsal gekörnelt; Dorsalkiele
verloschen; Postpetiolus apical parallelseitig; 2. Gastertergit basal und median gekörnelt und matt, apical
sehr fein gekörnelt und glänzend; die folgenden Tergite
zunehmend gänzender, sehr fein gekörnelt und sehr fein
punktiert; Gaster zum Ende hin von der Seite zusammengedrückt (vom 3.-4-Segment an); Bohrerklappen 1,9 mal so
lang wie die Tibien III; Bohrer schlank, deutlich abwärts gebogen, mit feinem Nodus und feinen Zähnen (Abb.
22).
Palpen bräunlich; Mandibeln überwiegend schwarz, basal
gelbbraun gezeichnet; Fühler bis etwa zum 14.Glied hellbraun, Spitze verdunkelt; Kopf, Mesosternum, Mittelsegment und Gaster schwarz; Prothorax, Mesoscutum, Scutellum, Mesopleuren und Metapleuren rotbraun und schwarz
gezeichnet; Tegulae dunkelbraun; Flügelbasis weißgelb;
Vorderflügel mit zwei undeutlich begrenzten dunklen Binden, die äußere mehr oder weniger deutlich in zwei Binden aufgespalten, die Basalhälfte der Radialzelle unpigmentiert; Pterostigma dunkelbraun, Basis hell; Coxen
hell rotbraun und dunkelbraun gemustert; Hinterbeine
sonst mittel- bis dunkelbraun, Basis der Tibien deutlich
weiß geringelt; vordere Beine mit der gleichen Zeichnung,
aber heller.
Kopf 79 breit"; Thorax 138 lang, 55 breit (Mesoscutum);
Vorderflügel 330 lang; 1.Gastersegment 60 lang; Postpetiolus 30 lang, 30 breit; 2.Segment 50 lang, 49 breit;
Tibien III 104 lang; Bohrerklappen 204 lang; Körper etwa
390 lang.
6 unbekannt.
Verbreitung: Polen, Deutschland, Österreich.
Maße in 1/100 mm.
408
Gelis canariensis sp.n.
Holotypus (9): "Gr. Canaria, Dünen, Maspalomas, 6.-18.
IV.1976, H.WOLF" (HORSTMANN).
9: Schläfen kurz und sehr stark verengt (Abb.2); Gesicht deutlich breiter als die Stirn; Fühler schlank,
fadenförmig (Abb.9)? Spitzen bei beiden Fühlern abgebrochen; Wangenraum 0,9 mal so breit wie die Mandibelbasis; Clypeus klein, vom Gesicht getrennt, im Profil
wenig gerundet; sehr fein gekörnelt und sehr fein zerstreut punktiert, Endrand lamellenförmig abgesetzt, median fast gerade; Kopf gekörnelt, Bereich der Wangen
stellenweise fast glatt; Pronotum lateral, Mesopleuren
und Metapleuren jeweils fast ganz glatt; Pronotum an den
Rändern etwas gestreift; Mesoscutum und Mesosternum fein
gekörnelt und sehr fein punktiert, mit Seidenglanz; Scutellargrube fein gestreift; Areola kaum geschlossen;
rücklaufender Nerv mit zwei Fenstern; Nervellus bei l/4
seiner Länge sehr deutlich gebrochen; Beine schlank, Femora III 4,2 mal so lang wie hoch; Mittelsegment kurz,
vollständig gefeldert; die vorderen Seitenfelder gekörnelt, die anderen Felder sehr fein gekörnelt oder stellenweise glatt, stark glänzend; Area superomedia etwas
länger als breit (Abb.lö); Area petiolaris lateral nur
sehr fein gerandet, flach, an den Rändern kurz gerunzelt;
1. Gastersegment schlank, zum Ende erweitert; Dorsalkiele nur an der Basis des Petiolus angedeutet; die drei
vorderen Gastertergite gekörnelt, matt, jeweils zum Ende
hin feiner gekörnelt und glänzender; die folgenden Tergite sehr fein gekörnelt und sehr fein und sehr zerstreut punktiert, glänzend; Bohrerklappen 1,2 mal so
lang wie die Tibien III; Bohrer gerade, mit deutlichem
Nodus und deutlichen Zähnen (Abb.23).
Palpen braun; Mandibeln gelbrot, Zähne dunkel; Kopf,
Fühler und Prothorax hellrot; Fühler anscheinend zur
Spitze hin schwach verdunkelt (soweit erhalten); Mesoscutum, Scutellum, Mesopleuren und Metapleuren rot und
schwarz gemustert; Mesosternum, Mittelsegment und Gaster
schwarz; Tegulae braun; Flügelbasis braun und weißgelb
gemustert; Flügel mit zwei deutlichen mittelbraunen Binden, die äußere im Bereich der Radialzelle mit einem unpigmentierten Fenster; Pterostigma dunkelbraun, Basis
409
weiß; Hinterbeine dunkelbraun, Basis der Coxen und der
Trochanteren hellrot gezeichnet, Basis der Tibien weiß
geringelt; vordere Beine mit der gleichen Zeichnung,aber
heller.
Kopf 126 breit; Thorax 204 lang, 99 breit; Vorderflügel 408 lang; 1.Gastersegment 89 lang; Postpetiolus 42
lang, 49 breit; 2.Segment 64 lang, 102 breit; Tibien III
159 lang; Bohrerklappen 185 lang; Körper etwa 500 lang.
d unbekannt.
Verbreitung: Kanarische Inseln.
Gelis nitida sp.n.
Holotypus (9): "A, T, St. Jakob i. Def., Sentenböden,
18.8.73, 2600 m, HAESELBARTH" (= St. Jakob im Defereggental/Osttirol) (HORSTMANN).
Paratypen: 1 9 "Messaure, Swed., IX.6.1971, Karl MÜLLER" (TOWNES); 1 9 "13 V 26, MS, window" (= Monk's
Soham/Suffolk), "British Isles, C. MORLEY Coll., B.M.
1952-159" (London).
9: Schläfen mäßig lang und wenig verengt (Abb.3); Gesicht etwas breiter als die Stirn; Fühler 24-gliedrig,
schlank (Abb.10), fadenförmig, vorletzte Glieder knapp
so lang wie breit; Wangenraum 1,5 mal so breit wie die
Mandibelbasis; Clypeus vom Gesicht scharf getrennt, im
Profil deutlich gerundet, basal bis über die Mitte kräftig und dicht punktiert auf glattem Grund,Endrand schmal
lamellenförmig, wenig vorgerundet; Kopf stark glänzend,
Gesicht und Stirn mit sehr zart gekörneltem, Scheitel
und Schläfen mit glattem Grund; Gesicht deutlich fein,
Stirn und Scheitel fein und zerstreut, Schläfen sehr
fein und sehr zerstreut punktiert; Pronotum gekörnelt
und dazu fein zerstreut punktiert, in der Furche fein
gerunzelt; Mesoscutum, Scutellum, Mesopleuren, Mesosternum und Metapleuren stark glänzend, mit sehr fein gekörneltem oder glattem Grund, dazu fein und zerstreut punktiert; Areola offen; rücklaufender Nerv mit zwei Fenstern; Nervellus bei l/3 seiner Länge deutlich gebrochen;
Beine mäßig schlank, Femora III 4,1 mal so lang wie hoch;
Mittelsegment kurz, fein gefeldert; Dorsolateralleisten
teilweise in Runzeln aufgelöst; dorsale Felder gekörnelt,
ziemlich matt; Area superomedia etwas länger als breit
410
(Abb.17); Area petiolaris lateral kräftig gerandet,etwas
eingesenkt, fein gekörnelt und gerunzelt, glänzend; 1.
Gastersegment gedrungen, dorsal fein gekörnelt, apical
fast glatt; Dorsalkiele sehr fein, bis zur Basis des
Postpetiolus reichend; Postpetiolus zum Ende hin erweitert; 2.Tergit basal und median sehr fein gekörnelt,
apical mit glattem Grund; Gastertergite sehr fein und
sehr zerstreut punktiert; Bohrerklappen 1,6 mal so lang
wie das 1. Gastersegment; Bohrer gerade, mit feinem Nodus und feinen Zähnen (Abb.24)Schwarz; Tegulae dunkelbraun; Flügelbasis gelblich;
Pterostigma mittelbraun, Basis aufgehellt; Flügel nicht
getrübt; Trochantellen, Spitzen der Femora und die Tibien gelbbraun; Tarsen etwas dunkler.
Kopf 91 breit; Thorax 157 lang, 75 breit; Vorderflügel
360 lang; 1.Gastersegment 68 lang; Postpetiolus 33 lang,
58 breit; 2.Segment 55 lang, 104 breit; Tibien III 111
lang; Bohrerklappen 102 lang; Körper etwa 440 lang.
6 unbekannt.
Verbreitung: Nordschweden, Südengland, Österreich.
Variation: Die drei bisher bekannt gewordenen Exemplare der Art unterscheiden sich in einigen Details, das
hängt möglicherweise mit den großen Entfernungen zwischen ihren Fundorten zusammen. Die obige Beschreibung
bezieht sich auf den Holotypus. Das Weibchen aus Nordschweden weicht dadurch ab, daß das 2.Gastertergit basal
und median deutlich gekörnelt und relativ matt und nur
apical glänzend und fast glatt ist. Das Weibchen aus
Südengland weicht ebenfalls durch ein etwas stärker gekörneltes 2. Gastertergit ab, dazu durch gelbbraune Femora und schmal hell gerandete Gastertergite.
Gelis fumipermvs sp.n.
Holotypus (9): "Glees, Ahrweiler, X 72, leg. BONEß"
(bei Bonn),
"ex Hülsen von Astragalus glycophyllus"
(HORSTMANN).
9. Schläfen kurz und deutlich verengt (Abb.4); Gesicht
deutlich breiter als die Stirn; Fühler 33-gliedrig,
mäßig schlank (Abb.11), zum Ende hin etwas zugespitzt,
vorletzte Glieder so lang wie breit; Wangenraum so breit
wie die Mandibelbasis; Clypeus klein, stark bucklig, ba411
sal gekörnelt und deutlich fein punktiert,Endrand schmal
lamellenförmig, vorgerundet; Kopf gekörnelt,stellenweise
sehr fein und sehr zerstreut punktiert; Schläfen glänzender und deutlicher punktiert; Thorax fein gekörnelt
und fein zerstreut punktiert; Pronotum in der Furche
deutlich gestreift; Scutellargrube nicht gestreift; Speculum glatt; Scheibe der Mesopleuren mit feinen Längskörnelreihen, stellenweise fein längsgestreift; Metapleuren ventral deutlich gerunzelt; Areola fein geschlossen; rücklaufender Nerv mit zwei Fenstern; Nervellus bei l/3 seiner Länge sehr deutlich gebrochen; Beine
mäßig schlank, Femora III 430 mal so lang wie hoch; Mittelsegment kurz, vollständig und deutlich gefeldert; die
vorderen Seitenfelder nur gekörnelt, die anderen Felder
zusätzlich deutlich gerunzelt; Area superomedia etwas
länger als breit (Abb.l8); Area petiolaris lateral fein
gerandet, etwas eingesenkt, quergerunzelt; l.Gastersegment kurz und breit, zum Ende hin erweitert; Dorsalkiele
nicht ausgebildet; die beiden vorderen Gastertergite gekörnelt, matt, jeweils zum Ende hin feiner gekörnelt und
glänzender; die folgenden Tergite zunehmend glänzender;
Bohrerklappen so lang wie das 1. Gastersegment; Bohrer
gerade, gedrungen, mit kurzer Spitze, deutlichem Nodus
und deutlichen Zähnen (Abb.25).
Schwarz; Palpen dunkelbraun; Mandibeln (Zähne dunkel),
Fühlerbasis (bis etwa zum 5«Glied), Beine, Spitze des
Postpetiolus und 2.-4«Gastertergit hellrot; Prothorax
frontal rotbraun gerandet; Tarsen zur Spitze hin verdunkelt; Tegulae bräunlich; Flügelbasis weißgelb; Vorderflügel mit zwei deutlichen mittelbraunen Binden; Pterostigma dunkelbraun, Basis breit hell.
Kopf Il8 breit; Thorax 176 lang, 88 breit; Vorderflügel 345 lang; 1.Gastersegment 80 lang; Postpetiolus 39
lang, 71 breit; 2.Segment 52 lang, 108 breit; Tibien III
141 lang; Bohrerklappen 75 lang; Körper etwa 470 lang.
d unbekannt.
Verbreitung: Nordwestdeutschland.
Gelis obscupipes sp.n.
Holotypus (9): "Trelleck Beacons, MM, 10.vi.1936,
E.B.B. & J.F.P.,B.M.1936-399" (in Gwent/Wales) (London).
412
Paratypen: 2 99 aus Farnham Common, Buckinghamshire,
vi.1934 (1 9 HORSTMANN, 1 9 London); 19 aus Bovey Heathfield, Devon, ix.1932 (London); 1 9 aus Oxford, v.1980
(TOWNES); 1 9 aus dem Park Metzger/Spessart, Bayern, 18.
9.1967 (HORSTMANN); 1 9 aus Pizzigghettone, Lombardia,
17.6.1973 (TOWNES).
9: Schläfen kurz und deutlich verengt (Abb.5); Gesicht
etwas breiter als die Stirn; Fühler 24-gliedrig, schlank
(Abb.12), fadenförmig, vorletzte Glieder etwas länger
als breit; Wangenraum wenig breiter als die Mandibelbasis; Clypeus vom Gesicht deutlich getrennt,deutlich vorgerundet, fein gekörnelt und sehr fein punktiert, glänzend, Endrand schmal lamellenförmig, wenig vorgerundet;
Kopf gekörnelt, matt, Scheitel und Schläfen glänzender;
Thorax gekörnelt; Scutellargrube nicht gestreift; Speculum an einer kleinen Stelle glatt; Areola nicht geschlossen; rücklaufender Nerv mit zwei getrennten Fenstern; Nervellus bei l/3 seiner Länge deutlich gebrochen;
Beine mäßig gedrungen, Femora III 338 - 4,1 mal so lang
wie hoch; Mittelsegment rundlich, fein gefeldert, in den
Feldern gekörnelt; Dorsolateralleisten und Costulae zuweilen stellenweise verloschen; Area superomedia länger
als breit (Abb.19); Area petiolaris lateral vollständig
begrenzt, flach, fein gekörnelt und glänzend; l.Gastersegment gedrungen, bis zum Ende erweitert, ohne Dorsalkiele, dorsal gekörnelt; 2.Tergit vollständig gekörnelt;
3-Tergit basal gekörnelt und relativ matt, apical glänzend; die folgenden Tergite sehr fein strukturiert, fast
glatt und stark glänzend; Bohrerklappen so lang wie das
1. Gastersegment (bei der Mehrzahl der Paratypen sind
die Bohrerklappen etwas eingezogen, so daß ihre Länge
nicht sicher zu erkennen ist); Bohrer gerade, gedrungen,
mit kurzer Spitze, deutlichem Nodus und feinen Zähnen
(Abb. 26).
Schwarz; Fühler am Annellus gelb geringelt; Tegulae
dunkelbraun; Flügelbasis hellgelb; Vorderflügel mit zwei
deutlichen hell- bis mittelbraunen Binden, die äußere
ohne Fenster im Bereich der Radialzelle; Coxen dorsal
dunkelbraun, ventral gelbbraun; Trochanteren dunkelbraun;
Trochantellen gelblich; Femora basal bräunlich, apical
gelbbraun; Tibien und Tarsen jeweils basal und median
413